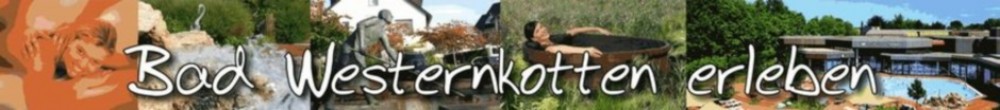Von Axel Heimsoth
Erstabdruck in „Westfälische Zeitschrift“ 159, 2009, S. 303-319
[Den Aufsatz habe ich ca. 2020 vom damaligen Stadtarchivar Hans Peter Busch im Rahmen der Arbeiten am geplanten Stadtbuch „Geschichte der Stadt Erwitte“ bekommen. Der Text ist an die heutige Rechtschreibung angepasst, kleine Transkriptions-Fehler sind nicht ausgeschlossen. WM, 09.10.2025]
Die Rolle der Infrastruktur im Rahmen von Modernisierungsdebatten
Warum gab es eine Wiederentdeckung des Hellwegs? Jede Rezeptionsgeschichte beginnt zunächst mit der Frage, wer sich zu welchem Zeitpunkt mit dem Thema beschäftigt hat. Im Falle des Begriffes „Hellweg“ gilt es zunächst zu erarbeiten, wie die Anwohner damit umgingen. Wurde der Hellweg zu jedem Zeitpunkt mit dem gleichen Interesse betrachtet oder wurde er auch mit Nichtachtung gestraft?
Auf einer anderen Ebene ist der Diskurs der Wissenschaftler, Literaten und Kulturschaffenden angesiedelt. Sie setzten sich im 20. Jahrhundert mit dem Hellweg auseinander. Historisch wurde aufgearbeitet, welche Funktionen und welche Bedeutung er zur römischen Zeit (als Militärstraße), im Früh- und Hochmittelalter (Kaiser- und Königsstraße) und bis zur Frühen Neuzeit (Handelsstraße) hatte.[2] Auffällig ist, dass sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch niemand für diese Geschichte interessiert hatte. Offensichtlich war die in der Literatur als so bedeutend hervorgehobene West-Ost-Verbindung zeitweilig völlig in Vergessenheit geraten, um dann ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Renaissance zu erleben. Dieser Wandel in der Wahrnehmung soll hier vorgestellt werden. Nicht berücksichtigt werden sollen weder die Funktionen des Hellwegs noch die Rezeption des Begriffs im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit.
Die ersten Belege zum Begriff „Hellweg“ für Westfalen finden sich in den Quellen des späten 13. Jahrhunderts.[3] Der Dortmunder Archivar Karl Rübel hatte für seine Stadt eine Vielzahl von Schreibweisen für den Hellweg gefunden.
Dortmund durchschneidet der „Westenhellweg“ und der „Ostenhellweg“. Für beide Straßenbezeichnungen hat Rübel eine Reihe von Belegen zusammengetragen.[4] Diese alltagssprachlichen Verwendungen des Begriffs „Hellweg“ beziehen sich auf die Bezeichnung des Weges, wie er noch im 17. Jahrhundert zu finden ist. Während des 30-jährigen Krieges wendeten sich westfälische Städte wegen „am Hellweg ausgestandenen Drangsalen“ an den preußischen Kurfürst Georg Wilhelm.[5] Neben den Wegebezeichnungen wird der Begriff aber auch zur Landschaftsbezeichnung genutzt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird die „Gegend des Hellwegs“ als Korngebiet bezeichnet. Friedrich August Alexander Eversmann spricht 1804 in seinem Werk über die Eisen- und Stahlerzeugung über das „Getreide vom Hellweg, der Soester Börde“ und anderer Gegenden, welches in das südlich gelegene Sauerland gehandelt würde.[6] In einem Presseartikel von 1816 findet sich eine Anekdote von einem „Hellweger Wehrmann“, der sie 1814 während der Besetzung von Paris erlebt haben soll.[7] Interessanter als die alltägliche Verwendung des Begriffs „Hellweg“ ist eine zweite, die weit über eine bloße Wege- oder Landschaftsbezeichnung hinausreicht. Hier wurde der Hellweg innerhalb einer Umbruchssituation, die durchaus als Krise eingeschätzt wurde, als Baustein zur Konstruktion einer regionalen Identität verwendet. Nicht zufällig fiel die Wiederentdeckung des Begriffs „Hellweg“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts in eine Phase anstehender Infrastrukturmaßnahmen, über deren Sinn und Zweck debattiert wurde.
Der preußische Staat plante seine am Ende der Befreiungskriege hinzugewonnen Territorien, das Rheinland und Westfalen, durch Chausseen mit dem Zentrum, Potsdam und Berlin, zu verbinden.[8] Mit der Baumaßnahme veränderte sich eine Verkehrslandschaft, die bisher nur die Instandsetzung des Naturwegs gekannt hatte. Zum Zweiten existierte nun eine durchgehende Verbindung in Westfalen, die nicht mehr durch eine Reihe von Territorien verlief, sondern allein unter die Verantwortung des preußischen Staats fiel. Eine Analyse der Infrastrukturdiskussionen in diesem Dortmund-Soester Raum muss leisten, die Bedeutungszusammenhänge und Motive der Personen und Gruppen herauszuarbeiten, die sich mit dem Hellweg beschäftigt und ihn explizit und über das Maß einer Landschafts- und Wegebezeichnung hinaus verwendet haben. Warum wurde der Begriff „Hellweg“ zu diesem Zeitpunkt wiederentdeckt? Eine solche Rezeptionsgeschichte zum Hellweg ist eine umfassend zu verstehende Begriffsgeschichte.[9]
Vom Hellweg zur Chaussee
Die Berliner Regierung forderte 1815 den Freiherrn von Vincke auf, eine Übersicht der bestehenden und sich im Bau befindlichen Chausseen in seinem Gouvernement zu erstellen.[10] Vincke wandte sich ein Jahr später in einem Zeitungsartikel mit dem Wunsch an seine westfälischen Landsleute, sie sollten sich wie die Engländer engagieren und selber anstehende Chausseeprojekte finanzieren. In diesem Artikel, „Bau der Kunststraßen durch Privat-Vereinigung“, warf er zudem der ehemals freien Reichsstadt Dortmund vor, in den 1780er-Jahren den preußischen Chausseebau behindert zu haben: „Man hat es sogar erlebt, dass der Vorstand einer bedeutenden Stadt, damals noch eine fremde Insel in unserer Mark, aus kurzsichtiger Besorgnis gefährdeter Territorial-Rechte, die Ablenkung der Wegelinie von dieser Stadt erzwang.“[11]
Vinckes Aufruf zum finanziellen Engagement ist bemerkenswert, forderte er doch ein gemeinnütziges Handeln von Teilen der Bevölkerung ein, die aus regionalen Wirtschaftsinteressen an dieser finanziell aufwendigen Maßnahme interessiert waren. Doch gab es ein solches „bürgerliches Engagement“? Vinckes Ruf verhallte zwar nicht völlig ungehört, aber er versandete. Vincke hatte das finanzielle Potenzial seiner Landsleute und auch ihre Bereitschaft überschätzt, sich für diese Belange einzusetzen. Sie hatten sich bisher – sowohl was den Chaussee- als auch den Kanalbau anging – allein auf den Staat verlassen. Es hatte seinen Grund, dass der preußische Staat 1769 eine Wegebauordnung erlassen musste. Die Anwohner waren so zu Hand- und Spanndiensten verpflichtet. Gegen Androhung von Strafen sollten sie die Naturwege instand halten.[12] Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen Vinckes und der Realität thematisierte 1829 ein Zeitungsautor: „Was uns Deutschen im Allgemeinen noch fehlt, ist der englische Gemeingeist zum Bau der Kunststraßen, Eisenbahnen und Kanäle, welcher durch Parlamentsdebatten und durch die Öffentlichkeit geweckt wird. Nicht der Staat, sondern die Aktionäre in England machen diese wichtigen Anlagen, wogegen wir Alles von der Staatskasse verlangen.“ [13]
Nicht von privater, sondern von staatlicher Seite ging nach 1815 die Initiative aus, den Hellweg zur Chaussee auszubauen. Von Unna nach Soest und weiter nach Lippstadt legte Preußen die Chaussee an. Freiherr von Vincke koordinierte die Baumaßnahme. In einem „Chaussee-Bau-Plan“ betonte man 1817, dass der Weg „über Erwitte und Unna … besonders für die dortige Kornreiche Gegend und den überaus schwer zu passierenden Boden wichtig“ sei.[14] Diese Wegelinie gehört wie zwei andere zu denen, die „militärisch und für den Handel und das Gewerbe fast gleich wichtig [sind]. Derjenige [= Weg] über Unna dürfte zuerst zu vollenden sein, weil davon am wenigsten fehlt.“[15] Geplant war, die Kunststraße einige hundert Meter weiter südlich vom alten Naturweg, den Haarstrang hinauf, zu errichten. Die Wegebauer verließen also die Linie des Hellwegs. Oberinspektor Knoth schrieb am 1. Oktober 1816: “ … so war es das zweckmäßigste, soviel als möglich gerade zu gehen und sich von der alten Straße zu entfernen.“[16]
Der Beamte hatte schon das ausgesprochen, was bald Realität werden sollte. Er bezeichnete den Hellweg als „alte Straße“. Der Gegensatz „alt“ und „neu“ bestimmte die Korrespondenz zwischen der Bauverwaltung und den Anwohnern in Fragen zur Infrastruktur. Der „alte Hellweg“ stand der „neuen Straße“ gegenüber.[17] Der Naturweg Hellweg war überflüssig geworden. 1819 war die Chaussee von Unna bis Soest fertiggestellt. Die Arnsberger Bezirksregierung forderte nun dazu auf, auf dem Wegeabschnitt von Unna bis Erwitte den Hellweg abschnittsweise zu verkaufen. [18] Der Naturweg wurde schmaler und die gewonnenen Flächen umgepflügt. Zwischen 1822 und 1828 fanden die Verkäufe von Parzellen zwischen Unna und Hemmerde statt.
Und wie verhielt sich die Bevölkerung zu dieser Maßnahme? Sie begrüßte die Anlage der Chaussee. Das Dorf Büderich wandte sich mit Eingaben zweimal an die Arnsberger Bezirksregierung und bat – vergebens -, die Kunststraße möge durch ihren Ort verlegt werden.[19] Wollte die Bevölkerung den Namen „Hellweg“ für die neue Kunststraße durchsetzen? Es finden sich in den Akten keine Hinweise, dass sie diesen Wunsch äußerte. Solche Forderungen scheinen nicht erhoben worden zu sein. Es finden sich nur Belege – sowohl in der Korrespondenz mit der Bauverwaltung als auch in der Presse – dass man die vom preußischen Staat vorgegebene Bezeichnung für die Chaussee akzeptierte. Sie hieß „Berliner Straße“.[20] Der Arnsberger Landrat Thüsing benutzte gegenüber dem Werler Schultheiß Fickermann die Formel von der „neuen Straße von Unna nach Wer!“ [21] Auch in den Chausseebaukarten wird dieser Wegeabschnitt als „Kunststraße“ und „Hellweg“ bezeichnet.[22] Wie sehr sich der Begriff im Bewusstsein der Bevölkerung verankert hatte, zeigt ein Brief von 1833, den die Vertreter der Stadt Soest und der Salinen Sassendorf und Westernkotten gemeinsam an Kronprinz Friedrich Wilhe1m aufsetzten. Verfasst hatte ihn der Werler Sälzer Clemens Freiherr von Lilien-Borg, der den Entwurf an den Soester Bürgermeister sandte. Diese Gruppe warb beim Thronfolger um Unterstützung beim Bau der Rhein-Weser Eisenbahn.
„Auch der Zufuhr des vorzüglichen Straßenbaumaterials von den Gewinnungs-Plätzen zu Belecke wird durch die Eisenbahn ein weiter Spielraum eröffnet. Die Unterhaltung der Berliner Straße auf 8 Meilen bis Brünninghausen wird hierdurch gesichert, ein bedeutender Vertrieb auf der Bahn veranlasst und die Transportkosten auf die Hälfte herabgesetzt. “ [23]
Die Kommunalverwaltung der Städte Unna, Werl und Soest hatte sich 1817/ 19 nicht für den Chausseeausbau engagieren und keine finanzielle Unterstützung leisten müssen. Der Staat übernahm die Planung, Finanzierung und Umsetzung der Bauarbeiten. Die preußische Verwaltung wandte sich zwar an die anliegenden Städte und fragte an, welche Beträge sie denn konkret bereit wären beizuschießen, doch es finden sich keine Antwortschreiben der Magistrate.[24] Anscheinend hatte man im Vorfeld lockere Zusagen gemacht, nun aber, da die Bauarbeiten schon angelaufen waren, sich jeder weiteren Unterstützung enthalten. Warum sollte man für etwas bezahlen, was schon im Bau war?
Die Idee einer Rhein- Weser Eisenbahn
Die Infrastrukturmaßnahme von 1819 war in der Jahreswende 1830/31 kein Thema mehr. Gut zehn Jahre nach dem Bau der Chaussee stand als viel bedeutendere Verkehrsmaßnahme die Anlage einer Eisenbahnlinie an. Verhandelt wurde das Projekt auf dem 3. Westfälischen Provinziallandtag in Münster. Zu den Aufgaben des Landtags gehörte es, in Ausschüssen Verkehrsprojekte zu erarbeiten. Hier in Münster fiel die Entscheidung, einen Antrag an König Friedrich Wilhelm IH. aufzusetzen und um den Bau einer Eisenbahnlinie zwischen der Lippe und der Weser zu bitten. Falls diese nicht von staatlicher Seite in Angriff genommen werden sollte, so bat man, solle die Genehmigung zum Bau der Bahn aus eigenen Mitteln, also durch eine Eigenfinanzierung, gegeben werden. Hinter diesem Projekt stand Friedrich Harkort, ein westfälischer Industrieller, welcher die Idee ausgearbeitet und aufgesetzt hatte. Neben und hinter Harkort standen aber weitere Landtagsabgeordnete, die sich in den kommenden Jahren vehement für die Anlage der Bahnlinie einsetzen sollten. An erster Stelle ist hier Clemens Freiherr von Lilien-Borg zu nennen. Der Werler Erbsälzer war zur Durchsetzung des Verkehrsprojekts die maßgebliche Persönlichkeit im Werl-Soester-Raum. Er vertrat die Interessen seiner Stadt und seines Betriebes sowohl nach außen, also gegenüber Berlin, als auch nach innen. Lilien-Borg war die Integrationsfigur und übernahm den Vorsitz bei den Eisenbahnkomitees, die zur Durchsetzung der verkehrspolitischen Ziele gegründet wurden.
Ein weiterer Abgeordneter des Landtags war Friedrich Wilhelm Werner Freiherr von Schorlemer, der Kreisdeputierte Lippstadts. Als Sekretär des Landtagsmarschalls vom Stein nahm auch der Soester Gerichtsassessor Johann Friedrich Wilhelm Ludwig von Viebahn teil. Nach Ende des Landtags konnte noch der Regierungsassessor Florens Heinrich von Bockum-Dolffs gewonnen werden. Er stammte aus einem Sassendorfer Erbsälzergeschlecht und sollte 1837 Landrat des Kreises Soest werden. Diese Gruppe setzte sich für die Rhein-Weser Eisenbahn ein. Sie arbeitete daran, die Linie entlang ihrer Städte, Ländereien und Unternehmen verlegen zu lassen, da sie sich wirtschaftliche Vorteile versprach.
Ende Januar 1831, kurz nach dem Landtag, hielt Freiherr von Schorlemer vor dem Gemeinderat Lippstadts einen Vortrag. Der bei Lippstadt auf seinem Gut Herringhausen ansässige Adelige sprach über das, was den Landtag in Münster bestimmt hatte: „Vortrag wegen der Eisenbahn von Minden nach Cölln erstattet im Lippstädter Gemeinderat den 29. Jan. 1831“. Schorlemer referierte über die Vorzüge von Eisenbahnen im Speziellen und dem zu erwartenden wirtschaftlichen Aufschwung Lippstadts im Besonderen. Er erinnerte an ihre Verkehrssituation zur Hansezeit und stellte seinen Gemeinderat vor die Wahl, entweder sich für den Bau der Bahn stark zu machen, oder dem wirtschaftlichen Untergang entgegen zu gehen.[25] Einen anderen Weg ging Friedrich Harkort. Der Industrielle veröffentlichte 1833 seine bekannte Schrift „Die Eisenbahn von Minden nach Cöln“ und warb mit ihr massiv für die Gründung von Eisenbahnkomitees.[26] Entlang der projektierten Strecke sollten, so Harkort, solche Vereinigungen deshalb entstehen, da sie in ihrem Abschnitt für die finanzielle und organisatorische Unterstützung bei diesem Verkehrsprojekt werben könnten. Die Initiative von Schorlemer und Harkort war nötig, da die preußische Regierung sich zurückhielt. Das staatliche Zögern, nach dem Chausseebau nun auch noch die Eisenbahnen zu finanzieren, ist in der angespannten Haushaltslage, aber auch in der als Konkurrenz zu den Chausseen empfundenen Eisenbahnen zu sehen. Die Chausseeeinnahmen stellten einen wichtigen finanziellen Faktor dar. Ein Eisenbahnnetz hätte – aus Sicht der preußischen Regierung – zu verminderten Einnahmen führen müssen. Rheinische und westfälische Adelige und Bürger standen nun vor der Situation, dass sie nicht auf das Engagement des Staates vertrauen konnten. Sie mussten Eigeninitiative zeigen. Sie wagten den Schritt und gründeten Eisenbahnkomitees. In Westfalen fanden sich in Minden, Lippstadt, Werl/Soest, Hörde und der Enneper Straße „Eisenbahnprotagonisten“ zusammen.
Die Frühphase des Eisenbahnbaues ist ganz entscheidend, um zu verstehen, warum westfälische Adelige und Bürger so hartnäckig über Jahre für die Anlage einer Eisenbahn fochten.[27] Die seit 1830/31, also dem Zeitpunkt des Westfälischen Provinziallandtags, geschürten Erwartungen sollten in den nächsten Jahren aufgegriffen und modifiziert werden. Das Engagement einer kleinen aber wichtigen Gruppe von „Eisenbahnprotagonisten“ zeigt, wie wirtschaftspolitische Ideen und kommunalpolitisches Handeln Hand in Hand gingen. Sie agierten ab 1833 als Vertreter ihrer Unternehmen und Gemeinden und suchten die Eisenbahn, den zu diesem Zeitpunkt modernsten Verkehrsträger, in ihren Raum zu ziehen. Harkort war Vorsitzender der Komitees von Hörde,[28] und das der Enneper Straße.[29] Lilien-Borg leitete das „Hellweg-Komitee“, welches seit 1833 in Werl und Soest bestand. Er lud den Freiherrn von Landsberg-Velen zur Teilnahme an einem Treffen ein, um zu versuchen, die Eisenbahn „in unseren Bereich“ zu ziehen.[30] Schorlemer machte sich in Lippstadt für die Sache stark. Zu einer Konferenz fand man sich im September 1833 im Solebad Königsborn bei Unna zusammen.[31] Unter Vorsitz von Clemens von Lilien-Borg besprach man das Eisenbahnprojekt. Als weitere Teilnehmer fanden sich der Hörder Bürgermeister Vahlkampf, Karl Freiherr von Bodelschwingh-Heide, Hauptmann Friedrich Wilhelm von Rappard (Rendant der Saline Königsborn), der Lünener Industrielle Casper Diedrich Wehrenbold, der Dortmunder Stadtrat Johann Heinrich Wilhelm Hammacher und noch weitere Teilnehmer ein. Sie sollten in den kommenden Jahren noch Mitstreiter hinzugewinnen und für ihre Bahnlinie kämpfen. Einen Monat nach der Konferenz trafen sich Vertreter der Salinen mit dem preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm in Arnsberg. Erschienen war für Sassendorf der Regierungsassessor Bockum-Dolffs, für Werl Clemens von Lilien-Borg und für Salzkotten Graf Clemens von Westphalen. Für ihre Privatsalinen warben sie beim Thronfolger zum einen um die Aufrechterhaltung des staatlichen Salzmonopols und zum anderen um Unterstützung bei der Realisierung einer Eisenbahnstrecke. Der Werler Lilien-Borg konnte nach seiner Rückkehr nach Werl in der Kollegial-Versammlung der Erbsälzer vermelden, “ …, dass Seine Königliche Hoheit der Kronprinz sich für diese Angelegenheit lebhaft interessiere. „[32]
Die Gruppe der Sälzer hatte ein gesteigertes Interesse an der Verwirklichung einer Bahnlinie, da sie am kostengünstigen Abtransport ihres Salzes, ebenso wie am Antransport von Kohlen gelegen war. Kohle und Salz waren Massengut. Die Kohle wurden auf den Salinen zum Betrieb der Dampfmaschinen und zur Erhitzung der Sole benötigt. Bisher war der Brennstoff nur über Landstraßen, also auf Kohlekarren zu beziehen gewesen.[33] Ein aufwendiges und vor allem kostenintensives Unterfangen. Dank einer Bahnlinie eröffnete sich für die Unternehmer die Möglichkeit, konkurrenzfähiger ihr Salz anzubieten. Die Werler Sälzer registrierten zu Beginn der 1830er Jahre eine größer werdende Konkurrenz von Produzenten aus Süddeutschland. Steinsalzsalinen aus dem Neckarraum drangen im Rheinland in Geschäftssparten ein, die bisher von den Werlern bedient worden waren.[34]
Auf die Initialzündung, also der Wunsch westfälischer Industrieller eine Bahnlinie entlang der Salinen (Soest/Sassendorf, Werl und Unna) und dann weiter ins westlich gelegene Kohlenrevier gebaut zu bekommen, folgte gegen Ende der 1830er Jahre die Ernüchterung. Das Projekt der Rhein-Weser Eisenbahn scheiterte aus finanziellen Gründen. Auch die Komitees entlang der Strecke konnten nicht genügend kapitalkräftige Finanziers zur Aktienzeichnung gewinnen. Das Mindener Komitee wandte sich nach Abschluss der Zeichnungsfrist 1836 an den Werler Lilien-Borg: „Selbst die Kohlengewerke von Hoerde und Witten und die Salinen des Hellweges, deren Interessen doch gewissermaßen gebieten dürfte, sich zu betheiligen, sind zurückgeblieben. Dies muss einen sehr üblen Eindruck machen, und kann insbesondere bei den künftigen Unterhandlungen mit den Staatsbehörden hemmend wirken.“ [35] Obwohl das Verkehrsprojekt gescheitert war, hatte sich der Personenkreis gefunden, der sich beim nächsten Vorstoß erneut engagieren sollte.
Staatliche Verkehrspolitik versus regionale Interessen
Das neue Projekt war die Köln-Mindener Eisenbahn, wie nun die Linie zwischen Rhein und Weser hieß. Nun tauchten andere Probleme auf. Weitere Städte machten sich Hoffnungen, die Bahnlinie über ihren Ort verlegt zu bekommen. Ab etwa 1842 begann ein zähes Ringen um die Streckenführung, bei dem es Sieger und Verlierer gab. Bevor aber König Friedrich Wilhelm IV., der 1840 den Thron bestiegen hatte, entschied, wer an die Bahn angeschlossen und damit einen wirtschaftlichen Aufschwung nehmen würde und wer nicht, suchten die Eisenbahnprotagonisten am Hellweg auf den Monarchen, die Ministerien und die Kölner Bahngesellschaft Einfluss zu nehmen. Sie bedienten sich zweier Mittel. Zum einen schickten sie Eingaben an die zuständigen Stellen und erklärten ausführlich, warum gerade über ihren Ort die Bahnlinie zu bauen sei. Zum anderen entdeckten sie die Presse. Während noch 1833 die Komitees die Zeitungen nicht für ihre Zwecke nutzten, erschienen ab 1843 Zeitungsartikel, die bei der Bevölkerung um Unterstützung in verkehrspolitischen Belangen warben.
Ende 1843 gewannen die Infrastrukturdiskussionen an Schärfe. Die zuständige Kölner Eisenbahngesellschaft begann, die einzelnen Städte gegeneinander auszuspielen. Da zwei Streckenführungen zwischen Dortmund und Bielefeld möglich waren, standen sich zwei Parteien gegenüber, die sich für die Anlage der Linie über ihre Städte stark machten. Die Bahngesellschaft schickte als Fachmann Geheimrat Mellin im Dezember 1843 nach Soest und Werl. Er sollte feststellen, welche finanziellen Zusagen die Städte geben würden, um den Zuschlag für die Bahnlinie zu bekommen. Der Magistrat und die Stadtverordneten Soests setzten an dem Tag, als der Vertreter der Kölner Eisenbahngesellschaft in ihrer Stadt eintraf und ihnen die rigiden Forderungen diktierte, eine Bittschrift an den König auf. Sie wandten sich deshalb an ihren Monarchen, da Mellin gefordert hatte, Soest müsse nun die gesamten Kosten für den notwendigen Grunderwerb der Eisenbahnanlage übernehmen, andernfalls müsse die Bahn über Hamm gebaut werden. Die Entscheidung habe bis zum nächsten Tag, dem 6. Dezember 1843, zu fallen, so Mellin, da er dann weiter nach Werl und Unna reisen müsse.[36] Da noch offen schien, ob die Bahn über Soest oder Hamm gebaut würde, wandte sich der Soester Magistrat mit einer Bittschrift an Friedrich Wilhelm. Die Soester hoben ihre Treue zur preußischen Monarchie hervor und argumentierten mit der Gefahr einer wachsenden Verarmung, falls die Bahnlinie nicht über Soest gebaut würde:
„Die einzige hiesige Erwerbsquelle außer dem Ackerbau blieb hier die frequente große Landstraße (der Hellweg) welcher 1819 unter dem Namen der Berliner Straße chaussiert wurde. Möchte nun, wie wir befürchten, die Eisenbahn über Hamm geführt werden, so würde Soest der bisherige Verkehr genommen und dasselbe lediglich auf seinem Ackerbau hingewiesen werden.“ [37]
Zehn Jahre waren seit der Gründung des Hellweg-Komitees (Werl/ Soest) ins Land gegangen. Erst jetzt, im Dezember 1843, findet sich zum ersten Mal der Begriff „Hellweg“ als ein Argument innerhalb der verkehrspolitischen Diskussionen. Die Landstraße „Hellweg“ würde nun als „Berliner Straße“ ihre Bedeutung dann verlieren, wenn nicht über Werl und Soest, sondern über Hamm die Eisenbahn gebaut würde. Mellin hatte in Soest Erfolg und bekam eine Kostenübernahme zugesagt. Er scheiterte jedoch in Werl, wo man sogar die bisher gegebenen Zusagen widerrief. [38] Trotz der von Soest in Aussicht gestellten Leistungen scheiterten 1843/44 die verkehrspolitischen Pläne der Vertreter des Hellwegraums. Der Versuch, durch eine Bittschrift an den König eine Entscheidung zugunsten Soests herbeizuführen, blieb ohne Erfolg. Im März 1844 legte sich König Friedrich Wilhelm IV. fest und vermerkte handschriftlich auf einem Schreiben: „Es ist also den Interessenten bekannt zu machen, dass Hamm auf jeden Fall berührt werden wird. “ [39] Damit hatte der König die seit Monaten sich in der Schwebe befindende Situation – soll nun Hamm an der Köln-Mindener Bahnlinie liegen oder nicht – beendet. Schon im Februar des Jahres hatte die Hammer Zeitung über den anstehenden Sieg über die Soester Konkurrenten frohlockt. In Plattdeutsch hatte ein Autor ein Gedicht verfasst, welches den Titel hat: „No Hamm kümbt de Isenbahn!“ Der Untertitel lautet:
„Allons perdu Hellwegianer
Es siegen nur die Grafschaftianer.“ [40]
Dieser Zweizeiler ist einer der wenigen Belege über die Fremdwahrnehmung des Raumes Hellweg. Der Autor hat sich für seine Leser nicht die Mühe gemacht zu erklären, was er unter beiden Begriffen verstehe. Es scheint dem Publikum klar gewesen zu sein. Zwischen „wir“ und „die“ scheint es – aus Sicht der Hammer – eine klare Trennung gegeben zu haben. Sie entspricht einer Mischung aus alten territorialen Zugehörigkeiten und landschaftlichen Besonderheiten. Zur Grafschaft Mark (den Grafschaftianern) zählte Hamm, der Verwaltungssitz des Territoriums im späten 18. Jahrhundert. Was der Hammer Autor ignorierte, ist das Faktum, dass auch Soest zur Grafschaft Mark gehört hatte. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts konnte Soest zwar als Stadtstaat einen gewissen Sonderstatus behaupten, doch hob König Friedrich H. die Stadtverfassung 1754 auf. [41] Wer aber waren die Hellwegianer? Der Verfasser rechnete offensichtlich Werl und Soest dazu, denn drei Ausgaben später ging er in der gleichen Zeitung erneut auf den – seiner Meinung nach – feststehenden Sieg Hamms über Soest ein. Er hatte das Lied „0 welche Lust von Hamm zu sein“ verfasst. In der Schlussstrophe lautete seine Quintessenz: Hamm werde mit Dampf kutschieren, während man in Soest lamentieren werde.[42] Wahrscheinlich rechnete der Hammer die Städte Dortmund und Unna nicht zu den Hellwegianern, denn zu diesem Zeitpunkt stand die Streckenführung zwischen Dortmund und Unna noch nicht zur Diskussion.
Die königliche Entscheidung die Köln-Mindener Eisenbahn über Hamm zu legen, rief in Soest und Werl Enttäuschung hervor. Während Soest nun verkehrspolitisch umdachte und forderte, die Bahn von Hamm über Soest nach Lippstadt zu bauen, also einen Umweg zu machen, blieb Werl bei seiner Strategie, eine Bahnlinie entlang des Hellwegs zu fordern. Eine Soester Delegation reiste nach Berlin und bekam eine Audienz bewilligt. Von ihrem König erfuhren sie, dass es seine Idee gewesen sei, in gerader Linie nun von Dortmund nach Hamm bauen zu lassen.[43] Bei diesem Treffen überreichten die beiden Soester, es handelt sich um Bürgermeister Schulenburg und den Stadtverordneten Vahle, Friedrich Wilhelm eine Bittschrift. Sie hätten „festes unerschütterliches Vertrauen“ zu ihm und sähen ihre „unlöschbare Liebe und Treue“ durch die geschichtliche und politische Beziehung zwischen ihm und ihrer Stadt begründet.[44] Ihre Argumente waren also historischer wie ökonomischer Natur.
Freiherr von Lilien-Borg analysierte in Werl, einen Tag nachdem in der „Münsterschen Zeitung“ die Nachricht vom Bau der Bahnlinie über Hamm erschienen war, die Situation. Er sah, dass, wenn die Entscheidung für Hamm bestehen bliebe, es kaum möglich war, die Anlage nun noch über seine Stadt zu führen. Er konstatierte: „So wäre Werl und das Herzogtum Westfalen umgangen und die Saline für ewige Zeiten benachteiligt!“ [45] Lilien-Borg hatte seit 1830/31, also dem dritten Westfälischen Landtag, für die Realisierung einer Bahnlinie entlang des Hellwegs und damit seiner Saline gekämpft. Die Gründe für das Scheitern sah er auch im getrennten Vorgehen der betroffenen Städte Dortmund, Soest und Lippstadt. [46] Wenige Tage später, am 17. April 1844, stellte er fest:
„Mir scheint auch, dass die Interessen des Hellwegs für Gewinnung der Eisenbahn hinreichend auseinandergesetzt von allen Behörden anerkannt sind … Das alle [= anderen Eisenbahnpläne] Hirngespinste [= sind] um den lieben Hellweg zu retten! Was hat dieses Land verbrochen? Um die Gewähr seines seit Jahrhunderten bereiteten Wohlstandes zu verlieren?“ [47]
Wieder drei Tage später vermerkte er: „Das heimlige Gefühl des Unrechts was der alten Straße widerfahren würde, wenn diese ganz außer Acht bleiben wird.“ [48]
Lilien-Borg war der Erste, der ausdrücklich sein Schicksal mit dem des Hellwegs, des „Iieben Hellwegs“, wie er es nannte, verband. Die Zukunft seiner Stadt und damit auch seiner Saline erschienen ihm in einem düsteren Licht. Ohne einen Bahnanschluss und, ja schlimmer, mit einem solchen für die Nachbarn, also die Konkurrenz (im Westen die Saline Königsborn bei Unna und im Osten die Saline Sassendorf) war es zunehmend schwieriger, das Massengut Salz zu vertreiben. Da kein Kanal und kein schiffbarer Fluss existierten, blieb nur der Transport über die Chausseen zu den Bahnhöfen in Soest, Dortmund oder Kamen. Die absehbare wirtschaftliche Benachteiligung ließ den Werler Sälzer handeln. Er setzte – zumindest war er maßgeblich beteiligt – eine Petition an König Friedrich Wilhelm auf und begründete, warum die Bahn über Soest und Werl zu bauen sei:
„Wir konnten nur in der Hoffnung leben, dass diese Verbindung in derjenigen Richtung gefördert werde, die die großen Handelsstraßen von der Weser und der Eibe seit mehr als ein Jahrhundert eingehalten hatten. Sind doch schon aus dem 16. Jahrhundert die Handelsstraßen von Minden und Cassel zum Rhein über Soest, Werl, Unna bekannt … Durch diese Richtung [= über Hamm] wird die hiesige Gegend, der sogenannte Hellweg, außer allen Verkehr gesetzt.“ [49]
Nun waren die Parameter abgesteckt, nach denen in den folgenden Jahren die Forderungen aus dem Dortmund-Soester Raum nach der Anlage einer Bahnlinie begründet wurden: Die Straße habe schon seit langer Zeit, in dieser Petition seit dem 16. Jahrhundert, bestanden. Es gelte zwei Flüsse, Rhein und Weser, zu verbinden. Beide Ströme entsprächen den Endpunkten der Köln-Mindener Eisenbahn. Und auch die von den Petenten 1844 ins Spiel gebrachten Orte Minden und Kassel waren als zentrale Bahnpunkte vorgesehen: Minden für die Köln-Mindener Eisenbahn und Kassel für die Westfälische („Kasseler“) Eisenbahn. Zwischen den beiden Endpunkten, also dem Rhein und der Weser, läge – als natürliches Verbindungsglied – der Hellweg. („Sind doch schon aus dem 16. Jahrhundert die Handelsstraßen … über Soest, Werl, Unna bekannt.“) In einem weiteren Petitionsentwurf – unsicher bleibt, ob er abgegangen ist – heißt es: „Die Gegend von Westfalen, der Hellweg genannt, ist bisher durch die große Handelsstraße … letztlich seit Jahrhunderten als der natürlichen Richtung am angemessensten.“ [50] Von den Werler Verkehrspolitikern wurde die Funktion des Hellwegs als Handelsstraße betont. Dass allein die kaufmännische Seite vorgestellt wurde, hatte strategische Gründe. Die von staatlicher Seite zu genehmigende Eisenbahnlinie war nur ökonomisch zu legitimieren. Es ging um die kostengünstigste und rentabelste Linienführung. Keine Rolle spielten militärische Überlegungen. Während in der zeitgenössischen Historiografie Johann Friedrich Möller Heerwege mit Hellwege gleichsetzte und sich auf seine militärische Herleitung auch Johann Suibert Seibertz bezog,[51] blieb diese von den Vertretern des Bürgertums und der Sälzer unerwähnt.
Im Juli 1844 setzte Werl eine eigene Bittschrift an den Monarchen auf. Entworfen hatte sie Lilien-Borg, der auf den historischen Stellenwert der Straße hinwies. „Schon seit Jahrhunderten bildete der Hellweg jene große Handelsstraße, welche den Rhein mit der Weser, der Elbe usw. verband.“ Die Vertreter der Stadt und der Saline hofften, der König werde sich für die „bestehende alte Straße, den ehemaligen Hellwege aussprechen“.[52] Die getrennten Vorstöße Soests und Werls scheiterten 1844/45. Der König legte fest, die Köln-Mindener Eisenbahn solle über Dortmund, Kamen und Hamm nach Bielefeld und weiter nach Minden gebaut werden. Eine zweite, die Westfälische Eisenbahn, ließ er von Kassel über Lippstadt und Soest nach Hamm anlegen.[53] Hamm war nun ein Eisenbahnknotenpunkt. Friedrich Wilhelm entschied sich für diese Variante und gegen alternative Routen, da durch eine andere Richtung „… meiner Intention zuwider, die Gegend von Lippstadt und Soest von der Eisenbahn-Verbindung ganz ausgeschlossen werden würde.“ [54]
Der Hellweg als Argument des Dortmund-Soester Eisenbahnkomitees
Die Benachteiligung, die von Seiten Unnas und Werls, also den Orten ohne Bahnanschluss zwischen Dortmund und Soest, empfunden wurde, brach Anfang 1849 offen aus. Die Eisenbahnprotagonisten hofften, auf den König noch Einfluss nehmen zu können, die Westfälische Eisenbahn entlang des Hellwegs bauen zu lassen. Aus „sicherer Quelle“ habe er erfahren, so schrieb der Königsborner Salinenrendant Rappard an den Werler Bürgermeister, dass der Verlauf der Strecke zwischen Hamm und Soest noch nicht feststehe. Rappard forderte, die nun ins Auge zu fassende Bahnlinie von Dortmund durch das Hörder Kohlenrevier und weiter über Unna und Werl nach Soest zu realisieren.[55] Nun zeichnete sich eine neue Streckenführung ab. Aus der ursprünglich entlang des Hellwegs vorgesehenen Linie, war aus ökonomischen Gründen eine Bahnstrecke über Hörde geworden. Nun sollte zwischen Dortmund und Unna ein südlicher Schlenker über diese Stadt gemacht werden. Das Hörder Kohlenrevier war zum einen wegen der reichen Kohlenlager für den Güterverkehr von Interesse. Zum anderen hatte Hermann Diedrich Piepenstock in Hörde ein Gelände gekauft, wo sein Werk, die Hermannshütte, 1843 seinen Betrieb aufnahm. Das Unternehmen trat in das Blickfeld der Verkehrslobby am Hellweg, da es eines der prosperierenden Eisen- und Stahlwerke werden sollte. [56]
Knapp eine Woche nach der Mitteilung Rappards an den Werler Bürgermeister trafen sich die an der Bahnlinie interessierten Personen in Unna zu einer Konferenz. Sie gründeten zur Interessenvertretung ein Komitee, dessen Vorsitz Lilien-Borg übernahm. Di e Komiteemitglieder schrieben den Hörder Bürgermeister und den Werler Magistrat an und baten um Unterstützung.[57] In der Presse warben sie massiv für ihr Anliegen, da ohne eine Eisenbahn der Verkehr abnehmen und der Wohlstand sinken würde. Das Komitee baute ein Angst-Szenario auf: entweder – oder. Entweder würden sie ihre verkehrspolitischen Ziele erreichen und damit den Wohlstand nicht nur für sich, sondern auch für ihre Nachkommen sichern, oder es drohe der Untergang. Diese Schwarz-Weiß-Malerei wurde eingesetzt, um eine möglichst breite Unterstützung vonseiten ihrer Bevölkerung zu gewinnen. Sie starteten eine Pressekampagne. Die am lokalen wirtschaftlichen Wohl ihrer Gemeinden interessierten Zeitungsredaktionen veröffentlichten jeden Aufruf des Eisenbahnkomitees. In den lokalen Zeitungen erschien am 17. Januar (Unna und Werl), 19. Januar (Soest) und 20. Januar (Dortmund) der Artikel: „Soll die Casseler Eisenbahn von Soest direkt nach Hamm oder über Werl, Unna, Hörde durch das Kohlen-Revier geführt werden?“ Als Autor war „Das erwählte Committee“ angegeben. Es begründete, warum die Bahnentlang des Hellwegs zu bauen sei:
„Jetzt oder nie, Mitbewohner des Hellweges! ist der Moment, wo die seit Jahrhunderten bestandene, durch die Notwendigkeit gebotene, zurzeit noch nicht völlig unterbrochene Handels-Straße zu erhalten resp. [= respektive] wiederherzustellen ist. “ [58]
Ein „Werlensis“ ordnete die Bedeutung des Hellwegs für ihren Raum historisch ein. [59] Im Kampf um den Zuschlag bei der Streckenvergabe war aber das historische Moment nur ein Argument, und nicht das stärkste. Es musste sowohl der Berliner Regierung als auch der ausführenden Bahngesellschaft signalisiert werden, dass man zu „Opfern bereit“ sei. [60] In der Werler Zeitung „Der Freimütige an der Haar“ veröffentlichte das Komitee ein Schreiben der heimischen Arbeiterschaft. Sie hätten ihre Unterstützung angeboten und würden für die Bahn drei Tage lang gratis arbeiten. Auch betrauerten sie, dass die Eisenbahn ihren Hellweg verlassen habe und durch eine öde und „unwirthbare[n] Gegend“ führen solle. [61] Der Duktus des sog. Briefes macht deutlich, dass ihn wohl das Eisenbahnkomitee zumindest „vorformuliert“ hatte. Es zeigt aber auch, dass breite Bevölkerungskreise – auch aus benachbarten Orten wurde signalisiert, sich unentgeltlich beim Bau zu beteiligen – bereit waren, das Bahnprojekt zu unterstützten.[62]
Dem Komitee war das gelungen, was jeder Marketing-Stratege zu hoffen sucht: Das Produkt, was man verkaufen will, in unserem Fall die Bahnlinie entlang des Hellwegs, kann nur erfolgreich verkauft werden, wenn es gelingt, glaubwürdig zu vermitteln, warum das Engagement eines jeden einzelnen zwingend notwendig ist. Die Vermittlung konnte idealerweise über die lokal erscheinenden Zeitungen erfolgen.
Worauf gründete die Bereitschaft der Bevölkerung dieses Raumes zur Unterstützung? Der kleine Personenkreis des Eisenbahnkomitees konnte glaubwürdig die Bedeutung einer west-östlich verlaufenden Verkehrsverbindung verdeutlichen. Es konnte von ihnen gezeigt werden, dass in der Vergangenheit der Hellweg für den Wohlstand ihrer Gemeinden verantwortlich gewesen sei. Waren nicht die großen Kirchen, die Rathäuser und anderen Profanbauten in den Hellweg-Städten aufgrund der Infrastruktursituation zur Zeit des Mittelalters entstanden? [63] Ein jeder, der in den Gemeinden spazieren ging, konnte diese Pracht aus der Hansezeit bewundern. War in der Vergangenheit der Hellweg der Garant des Wohlstandes, so war es nun die Eisenbahn. Die Glaubwürdigkeit speiste sich auch aus der Tatsache, dass beide Systeme ‚deckungsgleich‘ sind. Es besteht kein logischer Bruch, den Hellweg im neuen Kleid einer Eisenbahn zu sehen. Ein Verkehrsträger zu Lande wird durch einen anderen ersetzt.
Die Realisierung der Dortmund-Soester Eisenbahn
Auch die Initiative von 1849 scheiterte. Die Westfälische Bahn wurde – wie es schon Friedrich Wilhelm IV. festgelegt hatte – von Soest über Welver nach Hamm gebaut. Zwischen den Städten Soest und Dortmund, die nun über Bahnanschlüsse verfügten, lagen Unna und Werl.[64] Beide Städte konnten in den folgenden Jahren nur aus kleinräumigem regionalem Blickwinkel gegenüber der preußischen Regierung einfordern, warum jetzt auch noch zwischen Dortmund und Soest und damit natürlicherweise über Unna und Werl eine weitere Eisenbahnlinie zu bauen sei. Die Eisenbahnprotagonisten gründete 1851 erneut ein Eisenbahnkomitee. In Soest trat es am 24. Mai 1851 mit dem Ziel vonseiten „mehrere[r] Hellwegs Anwohner“ zusammen, eine Bahnlinie durchzusetzen.[65]
Ihre Strategie lautete, die lokale Wirtschaft zur Zeichnung von Aktien zu bewegen. Durch die finanzielle Beteiligung glaubte man, die staatlichen Stellen von der finanziell prosperierenden Region zwischen Dortmund und Soest überzeugen zu können. Nur wenn das Unternehmen auf ökonomisch festen Füßen stehen würde, war sicher, dass eine Konzession überhaupt in den Bereich des Möglichen rückte. Das neue Komitee ging nun einen Schritt weiter und trat (noch) professioneller auf. Die Mitglieder veröffentlichten nicht nur Aufrufe in den Zeitungen, sondern ließen eine eigene Denkschrift drucken, die mit folgender Sentenz eingeleitet wurde:
„Seit den grauen Zeiten des Mittelalters verband eine große und lebhafte Handelsstraße die alten Westphälischen Städte Dortmund, Unna, Werl und Soest. Die Straße hieß der Hellweg. Er vermittelte nicht allein den Verkehr dieser zur Zeit des Hansabundes großen und mächtigen Städte, sondern er war auch der Haupthandelsweg zwischen dem Rhein und Hamburg und Lübeck … “ [66]
Das Komitee betonte die historisch gewachsene Situation ihres Hellwegs und ging auf Tacitus und die Hanse ein. Ihr Hellweg drohe zu veröden: „Die ganze Gegend wetteifert, durch Freifuhren, Freiarbeiten und sonstige Opfer dem überwundenen aber nicht zurzeit besiegten Hellwege die uralte Handelsstraße wieder zu gewinnen.“ [67] Nun, nach einem zwanzig Jahre dauernden Kampf rückte der Bau einer Bahnlinie in greifbare Nähe. Das Dortmund-Soester-Eisenbahnkomitee erhielt schließlich die staatliche Genehmigung, eine Aktiengesellschaft gründen zu dürfen. Am 9. Juni 1852 druckte der „Hellweger Anzeiger“ den königlichen Erlass ab. Das Bemühen der Kommunalpolitiker und Unternehmer hatte Erfolg gehabt. Sie hatten die Anlage durchsetzen können, weil es gelungen war, die Bevölkerung ihrer Region zur Unterstützung zu gewinnen. Das verbindende Element stellte die Erinnerung an den Hellweg dar. Ebenso wichtig war es aber auch geworden, in Berlin eine Lobby aufzubauen und für ihr Anliegen zu werben. Hier standen aber ökonomische Argumente im Vordergrund. Die Transformation des Hellwegs in eine Eisenbahn fand statt. Diesen Prozess sah schon der Werler Bürgermeister Cloer. Er hielt 1853 anlässlich der Eröffnung der Bauarbeiten an der Dortmund-Soester Eisenbahn in der Nähe seiner Heimatstadt eine Rede und hob auf die Bedeutung des Hellwegs für seine Region ab. Seine Ansprache ist im „Hellweger Anzeiger“ veröffentlicht worden: „Meine Herren! Die Veranlassung zu unserer heutigen Versammlung an diesem Orte ist ein Ereignis der wichtigsten Art. Es gilt, den Hellweg zu seiner alten Größe zurückzuführen, es gilt, einer der ältesten Weltstraßen eine neue Bahn zu eröffnen. Unsere Vorfahren bauten in der grauen Vorzeit den Hellweg, und seit Jahrhunderten war er die größte Handels- und Heerstraße in Deutschland, bis vor wenigen Jahren die unabweisbare Richtung einer Eisenbahn von Dortmund über Hamm ihn seiner Anrechte, seines Glanzes für immer berauben zu wollen schien. Doch auch der Hellweg soll seine alten Rechte und, hoffen wir, mit diesen seine alte Größe wieder erlangen. Der Hellweg wird nunmehr umgewandelt in eine Eisenbahn und Sie, die Herren Baumeister haben die beneidenswerte schöne Aufgabe, dass Sie da, wo die Alten um den Norden mit dem Osten zu verbinden, den ersten Weg anlegten, nunmehr die Eisenbahn bauen. Möge dieselbe ebenso unter den Eisenbahnen sich den Rang oder die Vorrechte erstreiten und erhalten, wie der Hellweg Jahrhunderte hindurch sie gehabt hat!“ [68]
Die Bauarbeiten dauerten zwei Jahre. 1855 wurde die Dortmund-Soester Eisenbahn eröffnet. Die Eisenbahnprotagonisten wandten sich anderen Verkehrsprojekten zu. Der Erbsälzer Clemens von Lilien-Borg hatte schon nicht mehr den Baubeginn an der Strecke erleben können. Er verstarb 1852. Das Thema „Hellweg“ spielte sowohl in der Korrespondenz zwischen der Eisenbahnverwaltung und den Berliner Verwaltungsstellen keine Rolle mehr. Auch in der Presse taucht nach 1855 nicht mehr der Begriff „Hellweg“ im Rahmen der verkehrspolitischen Diskussionen auf. Das Eisenbahnkomitee hatte sich sang- und klanglos aufgelöst, nachdem die Fertigstellung der Bahn absehbar war.
Zusammenfassung
Die Wegebaupolitik Preußens hatte 1817 zu der schnellen Entscheidung geführt, den Hellweg zu einer Chaussee auszubauen. Die Planungen und Finanzierungen des Abschnitts Unna-Soest-Lippstadt verliefen reibungslos, da der Staat die Verantwortung übernahm. Er plante und finanzierte die bis 1819 fertiggestellte Anlage. Die Chaussee hieß, ohne dass sich Widerstand regte, „Berliner Straße“. Dagegen ‚verschwand‘ der Begriff „Hellweg“ in den Infrastrukturdiskussionen. Der „alte Hellweg“ stand der „Berliner Straße“ gegenüber. In der zweiten Phase tauchte der Plan einer Eisenbahnlinie auf. Die geniale Idee, mithilfe einer solchen Rhein und Weser zu verbinden, unterstützten seit dem Westfälischen Provinziallandtag (1830/31) die Salinenbesitzer und weitere Unternehmer und Kommunalpolitiker im Hellwegraum. Sie kämpften für die Anlage einer Bahnlinie entlang ihrer Städte, doch schwanden ihre Hoffnungen und Erwartungen in den 1840er-Jahren.
Mit dem Scheitern der Verkehrspläne änderten sie ihre Strategie. Die Eisenbahnprotagonisten am Hellweg bemühten sich um eine Öffentlichkeit und warben für ihr Anliegen. Ihr wichtigstes Instrument war die Presse. Der immer größer werdende Zeitungsmarkt eröffnete die Chance, sich für lokale und regionale Projekte zu engagieren und die Interessen zu artikulieren. Sie gründeten Eisenbahnkomitees und argumentierten mit der historischen und wirtschaftlichen Bedeutung ihres Hellwegs: So wie zur Hansezeit der Hellweg für den Wohlstand verantwortlich gewesen sei, so würde es nun die Eisenbahn, also der neue Hellweg, sein. Ihre Strategie ging auf. Die Bevölkerung teilte ihre Einschätzung vom Stellenwert des Hellwegs. Sie identifizierten sich über ihn mit dem Anliegen des Komitees und engagierten sich – der beste Beweis für die Existenz einer Region Hellweg. Regionale Identität bedeutet, dass die Bevölkerung eines Raumes sich gemeinsam über einen Wert verständigt und sich mit ihm identifiziert. [69] Die Instrumentalisierung des Hellwegs hatte in dem Moment ein Ende, als die Ziele erreicht waren. Wenn auch die bewusste Verwendung des Begriffs nicht mehr in der Korrespondenz der Eisenbahnprotagonisten und nicht mehr in der Presse zu finden ist, so muss von einer weiter bestehenden Identifikation der Bevölkerung mit dem Hellweg ausgegangen werden. Welcher Grad an Identifikation vorhanden war, lässt sich in Krisensituationen am deutlichsten verfolgen. Im Hellwegraum waren dieses die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert. Auf die Veränderungen und (politischen) Unsicherheiten nach Kriegsende reagierte man mit der Rückbesinnung auf traditionelle Werte wie dem „Hellweg“. Für das 19. Jahrhundert kann dagegen festgestellt werden, dass mit der Fertigstellung der Dortmund-Soester Eisenbahn 1855 der Hellwegraum den Anschluss an das Eisenbahnnetz und damit an die Moderne gefunden hatte. Ein Erfolg, den nur wenige Räume zu diesem Zeitpunkt aufweisen können.
[1] Der Beitrag wurde im Rahmen des „60. Tags der Westfälischen Geschichte, veranstaltet vom Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens in Verbindung mit der Historischen Kommission für Westfalen und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe am 5. April 2008 in Wer! vorgetragen. Er stützt sich auf die Ergebnisse meiner Dissertation, vgl. Axel Heimsoth, Die Wiederentdeckung des Hellwegs. Regionale Identität im Spiegel verkehrspolitischer Diskussionen bis zum Bau der Dortmund-Soester Eisenbahn, Essen 2006.
[2] Vgl. Albert K. Hömberg, Der Hellweg. Sein Werden und seine Bedeutung, in: ders., Zwischen Rhein und Weser. Aufsätze und Vorträge zur Geschichte Westfalens, Münster 1967, S. 196 -207 (Erstdruck 1960); Paul Leidinger, Der Westfälische Hellweg als frühmittelalterliche Etappenstraße zwischen Rhein und Weser, in: Westfälische Zeitschrift 149, 1999, S. 9-33.
[3] In Selehorst (bei Wiedenbrück) wird eine curtis (= ein befestigter Wirtschaftshof) als „quae appelatur Helewech“ bezeichnet; Westfälisches Urkunden-Buch, Bd. III. Die Urkunden des Bistums
Münster 1201-1300, bearb. V. Roger Wilmans, Münster 1859/ 78, Register bearb. v. Otto Werth, Münster 1921, Nr. 1116. Innerhalo eines Vertrages zu einer Erbteilung wird 1291 von Ländereien gesprochen „in bonis de Helewech“. Westfälisches Urkunden-Buch, Bd. VII. Die Urkunden des kölnischen Westfalens 1201-1300, bearb. v. Staatsarchiv Münster, Münster 19 01/08, Nr. 2206.
[4] vgl. Kar! Rübel, Dortmunder Finanz- und Steuerwesen, 1. Band. Das 14. Jahrhundert, Dortmund 1892. Es finden sich „Westen an dem Hellwege“ (5.250), „Westen op deme Heleweghe“ (5. 276) und „Ostene an dem Helwege“ (S. 256), „op deme Oestenhelewege“ (5. 276).
[5] Der Dreißigjährige Krieg und der Alltag in Westfalen. Quellen aus dem Staatsarchiv Münster, bearb. vom Staatsarchiv Münster, Münster 1998, Nr. 16, Sammlung von Kriegsvolk für die märkische Landesverteidigung, 1620 Mai 18, S. 67. In Hemmerde östlich von Unna findet sich Ende des 18. Jahrhunderts ein „Hilwegwith“, vgl. Oskar Rückert, Heimatblätter für Unna und den Hellweg, Unna 1949, S. 209.
[6] Friedrich August Alexander Eversmann, Die Eisen- und Stahl- Erzeugung auf Wasserwerken zwischen Lahn und Lippe und in den vorliegenden französischen Departements, Dortmund 1804 (Neudruck o. J.), S. 8.
[7] Hermann. Zeitschrift von und für Westfalen 57. Stück, 16. 7. 1816, S. 454. “ Als Paris eingenommen war, stand am Gitterthor des Garten Luxembourg ein Hellweger Wehrmann auf dem Posten.“ – Der Soldat verwehrte zwei adeligen Pariserinnen, die einen kleinen Hund dabeihatten, den Zutritt zu der Anlage mit den Worten: „De Rüe maut fut.“
[8] „Es wird dadurch [= neue Chausseeanlagen] eine möglichst kurze Verbindung der vorzüglichsten
Provinzial-Haupt-Städte mit Berlin bezweckt. Vorläufig bleiben jedoch die Provinzen jenseits der Eibe von dieser Darstellung so lange ausgeschlossen, bis der Wiener Kongress die Ungewissheit in Hinsicht der Grenzen dieser Provinzen beseitigt hat.“ Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (= GHStAPK), I. HA, Rep. 103, Nr. 892, Staatsminister Bülow an General-Postmeister Seegebarth, 12. 4.1814.
[9] Vgl. Dietrich Busse, Historische Semantik. Analyse eines Programms, Stuttgart 1987, S. 55 u. S.307.
[10] Vgl. Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Archiv, Münster (= LWL, Archiv) Reg. Münster II-l – 3, BI. 2, Vincke an die königliche Regierungskommission in Münster, 7. 7. 1815.
[11] Hermann. Zeitschrift von und für Westfalen 15. Stück, 20. 2. 1816, Ludwig v. Vincke, Bau der Kunststraßen durch Privat-Vereinigung, S. 113-116, 113; abgedruckt bei Hans-Joachim Behr / Jürgen Kloosterhuis (Bearb.), Aus Tagebuch und Aktenbänden – Schlüsseltexte von und über Vincke, in: Ludwig Freiherr Vincke. Ein westfälisches Profil zwischen Reform und Restauration in Preußen, hgg. v. denselben, Münster 1994, S. 537-728, hier Q 16, S. 610.
[12] Abgedruckt bei Alfred Bruns (Bearb.), Die Straßen im südlichen Westfalen, Münster 1992, S. 21-28; vgl. Axel Heim50th, Chausseebau zwischen Brügge und St. Petersburg, in: Ferdinand Seibt u. a. (Hg.): Transit Brügge-Novgorod. Eine Straße durch die europäische Geschichte, Essen 1997, S.473-479.
[13] Der Sprecher oder Rheinisch – Westfälischer Anzeiger (= RWA) Nr. 20, 11. 3.1829, Der alte Petrograph am Rheine: Über die Wasserverbindungen in Westfalen und am Niederrheine, Sp. 375-378, hier Sp. 376.
[14] GHStAPK, I. HA, Rep. 103, Nr. 892, BII. 24-46, hier BI. 38, Chaussee-Bau-Plan für die Königlichen Preußischen Staaten, Berlin, 10.4. 1817. Verfasst hatten ihn der Vizepräsident des Oberlandesgerichts von Kleve, Grolmann, und der Bauassessor Crelle.
[15] Ebd.
[16] LWL, Archiv, C 40 I A 114, Bd. 2, Bericht des Oberinspektors Knoth, I. 10. 1816.
[17] Vgl. Stadtarchiv (= StdA) Unna, A VII/4, 74, Brief von Steinen an den Unnaer Bürgermeister, 23.2. 1819. Vgl. ferner LWL, Archiv, C 40 K 17, Me, „Viertes und letztes Blatt des alten Hellwegs von Unna bis Werl“.
[18] Vgl. Julius Göddenhoff, Alter Hellweg für 1050 Taler, in: Heimat am Hellweg. Beilage zum Hellweger Anzeiger, F 16, 1958.
[19] Vgl. LWL, Archiv, C 40 I A 123, BII. 5-6.
[20] Vgl. LWL, Archiv, C 40 I A 113, BII. 26-27, Bericht Liebrechts, 24. 6.1821. Der preußische Oberbaurat Crelle verfasste 1818 den Bericht „Die Rhein-Straße oder Köln-Berliner Straße zwischen Unna und Paderborn“, LWL, Archiv, C 40 I A 122; abgedruckt bei Bruns, Straßen (wie Anm. 12), S.286-288.
[21] StdA Werl, E 49 Nr. 9, BI. 1, Brief vom 17. 11. 1817.
[22] Vgl. GHStAPK, XI. HA, F 52890, Topographische Karte des südlichen Teils der Soester Börde im Regierungsbezirk Arnsberg, 1825.
[23] StdA Soest, B XVI d I, Brief von Clemens von Lilien-Borg, 1.11.1833.
[24] Vgl. LWL, Archiv, C 40 I A 114, Bd. 2, BII. 8-9, 13. 12. 1816, Briefe des Geheimen Rats Liebrecht an die Städte Lippstadt und Soest und an die Werler Sälzer. Liebrecht schrieb erneut am 2. April 1817 die Bürgermeister von Lippstadt und Soest an und forderte sie auf, innerhalb von vierzehn Tagen die Summe zu nennen, die sie bereit seien zu zahlen; vgl. ebd. Bl. 46, 2.4.1817
[25] Vgl. Archiv des Freiherrn von SchorIemer zu Herringhausen, Akten, Best. C, Nr. 23. Akteneinsicht ist über das Archiv des LWL in Münster möglich.
[26] Friedrich Harkort, Die Eisenbahn von Minden nach Cöln, Hagen 1833 (Neudruck 1961). Friedrich Harkort hatte die Ergebnisse der englischen Lokomotivtests schon 1825 in der Zeitschrift „Hermann“ vorgestellt: 1 000 Zentner Ladung seien so in zehn Stunden von Duisburg nach Arnheim zu transportieren. Die Schiffer würden dafür acht Tage veranschlagen; vgl. Hermann Nr. 26, 30. 3. 1825, Friedrich Harkort, Eisenbahnen (Railroads); abgedruckt bei Louis Berger, Der alte Harkort. Ein westfälisches Lebens- und Zeitbild, 5. Aufl., Leipzig 1926, S. 160-162.
[27] Vgl. Axel Heimsoth, Ein Wunder der Technik? Die Einführung der Eisenbahnen in Westfalen, in: Anfechtungen der Vernunft. Wunder und Wunderglauben in der Neuzeit, hgg. v. Ute Küppers-Braun / Jutta Nowosadtko / Rainer Walz, Essen 2006, S. 243 -258.
[28] Vgl. RWA Nr. 95, 26. 11. 1834, (Kein Gewerke), Über die Eisenbahn von Hörde nach der Lippe, Sp. 1542-1545, hier Sp. 1545.
[29] Vgl. Wolfgang Källmann, Friedrich Harkort, Bd. 1: 1793-1838, Düsseldorf 1964, 5.103.
[30] Staatsarchiv (= StA) Münster, Landsberg-Velen (Dep.) 5488, Brief von Lilien-Borg, 13. 3. 1833.
[31] Vgl. StdA Soest, B XVI d 1, 22.9.1833.
[32] StdA Werl, Dep. Erbsälzer-Archiv, Sc VII 27 a, S. 294. Kollegial-Versammlung, 5. 11. 1833; vgl. auch Axel Heimsoth, Reisen bildet: Kronprinz Friedrich Wilhelm zu Besuch in Westfalen, in: Jahrbuch Westfalen, 62. Jg., 2008, S. 44-48.
[33] Vgl. Marie-Luise Frese-Strathoff / Kurt Pfläging / Joachim Huske, Der Steinkohlenbergbau im Bergrevier Hörde zur Zeit des Freiherrn vom Stein, Werne 2007, S. 128 u. 140
[34] Vgl. StdA Werl, Dep. Erbsälzer-Archiv, Sc XXI 16, Clemens von Lilien-Borg, P. M. Die Verbindung mit der Neckar Salinen betreffend, 1831, BII. 1-34; vgl. ferner Anlage Nr. 6, „Pro Memoria über die Westphälischen Salinen … „.
[35] StdA Werl, Dep. Erbsälzer-Archiv, Sv A III f 22, Brief vom 12.9.1836.
[36] StdA Soest, B XVI d 1, Protokoll vom 5.12.1843.
[37] StdA Soest, B XVI d 2, Brief an König Friedrich Wilhelm IV., 4.12.1843
[38] Vgl. StdA Werl, E 49 Nr. 23, BII. 44-45, Brief von Bockum-Dolffs an den Werler Bürgermeister Gordes, 16.12. 1843.
[39] GHStAPK, I. HA, Rep. 89, Nr. 29627, Brief vom Staats- und Kabinettsminister von Thile an Finanzminister von Bodelschwingh, 3. 3. 1844. Der Monarch verfasste den Vermerk am 31. März.
[40] Wochenblatt für die Stadt und den Kreis Hamm, Nr. 7, 14. 2. 1844, (v. B.L.), No Hamm kümbt de Isenbahn! Die erste Zeile kann mit „Wir Hellwegianer wollen uns geschlagen geben“ übersetzt werden.
[41] Vgl. Rolf Dieter Kohl, Absolutismus und städtische Selbstverwaltung. Die Stadt Soest und ihre Landesherren im 17. Jahrhundert, Münster 1974, S. 252-256.
[42] Wochenblatt für die Stadt und den Kreis Hamm, Nr. 10, 8.3.1844, (B.L.), 0 welche Lust von Hamm zu sein.
[43] StdA Soest, B XVI d 2, Protokoll des Soester Bürgermeisters Schulenburg und des Stadtverordneten Vahle, 28.4.1844
[44] Vgl. ebd.
[45] StdA Werl, Dep. Erbsälzer-Archiv, Sv A III f 23, 12.4.1844.
[46] Vgl. ebd.
[47] Ebd., Brief von Lilien-Borg an Viebahn, 17.4.1844.
[48] Ebd., 20.4.1844.
[49] Ebd., „Zur Petition an S. M. den König – Richtung der Rhein-Weser-Eisenbahn über Soest u. Werl“, April 1844.
[50] Ebd., „P. M. – Die Richtung der Eisenbahn von Dortmund nach Lippstadt betreffend“, April/Mai 1844.
[51] Westfälischer Anzeiger Nr. 80, 5. 10. 1804, Anonym [= Johann Friedrich Möller) Zur ältesten Geschichte der Wege und Heerstraßen in der Grafschaft Mark, Sp. 1265-1272, hier Sp. 1269. „Er erhielt von seinem Gebrauche den Nahmen, den er noch hat, Heerwege (Hellweg).“ Vgl. ferner Johann Suibert Seibertz, Die Straßen im Herzogtum Westfalen. Sonst und jetzt, in: Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde (Neue Folge: Westfälische Zeitschrift) 5, 1842, S. 92-121, hier S. 95.
[52] StdA Werl, Dep. Erbsälzer-Archiv, Sv A III f 23, Briefentwurf Lilien-Borgs an den König, 24.7.1844.
[53] Vgl. GHStAPK, I. HA, Rep. 77, Tit. 258a, Nr. 3, Bd. 1, BI. 158-159, Friedrich Wilhelm an das Staatsministerium, 9.3.1845
[54] Ebd.
[55] Vgl. StdA Werl, E 49 Nr. 23, Brief Rappards, 8.1.1849
[56] Karl-Peter Ellerbrock, Hördes Eintritt ins Industriezeitalter. Von Piepenstock zum Phoenix-Konzern, in: Hörde. Beiträge zur Stadtgeschichte. 650 Jahre Stadtrechte Hörde (1340-1990), hgg. v. Günther Högl / Thomas Schilp., Dortmund 1990, S. 98-111, hier S. 100; vgl. Karl-Peter Ellerbrock, Die Geschichte des „Phoenix in Hörde, Münster 2006.
[57] Vgl. StdA Dortmund, Best. 15, Nr. 395, BI. 166, Brief an den Hörder Bürgermeister, 11. I. 1849; StdA Werl, E 49 Nr. 23, Brief vom 14. I. 1849.
[58] Der Freimütige an der Haar Nr. 5. 17. I. 1849 (Das erwählte Committee), Soll d e Casseler Eisenbahn von Soest direkt nach Hamm oder über Werl, Unna, Hörde durch das Kohlen-Revier geführt werden? Der Artikel ist auch abgedruckt im Hellweger Anzeiger, Nr. 5, 17. I. 1849; Soester Kreisblatt, Nr. 6, 19. I. 1849, und im Anzeiger. Kreisblatt für den Kreis Dortmund Nr. 6, 20. I. 1849.
[59] Vgl. Der Freimütige an der Haar Nr. 8, 27. I. 1849 (Werlensis), Über die Vorteile einer Eisen-bahn für Werl und Umgegend, S. 31.
[60] Hellweger Anzeiger Nr. 6, 20. I. 1849, „Jetzt oder nie mehr eine Eisenbahn durch die gesegneten Fluren des Hellweges“. Auch in Dortmund hatte man die Notwendigkeit von Eisenbahnanlagen erkannt: „Ihr Alle bedenkt, dass es sich hier nicht um eine Sache handelt, in der wir unsern Nachkommen viel zu tun übriglassen müssen, bedenkt, dass das was wir jetzt vernachlässigen, später mit großen Opfern nur teilweise wieder gut gemacht werden kann, bedenkt, da wir den gerechten Tadel unsrer Kinder und Enkel bis ins X. Glied auf uns laden, wenn wir jetzt nicht kräftig handeln.“ Dortmunder Wochenblatt Nr. 25, 20.6.1846, Eisenbahn.
[61] Vgl. Der Freimütige an der Haar Nr. 10, 3. 2. 1849, Werl, S. 38. Der Brief der Handwerker und Arbeiter war auf den 19.1.1849 datiert.
[62] Der Freimütige an der Haar Nr. 8,27. 1. 1849, Werl: „Dem Beispiel der braven Werler sollen übrigens die Gemeinden zu Unna, Hörde, Aplerbeck usw. bereits gefolgt sein … „.
[63] An die wirtschaftlich erfolgreiche Hansezeit erinnerte ein Zeitungsartikel anlässlich der Einweihung der Dortmund-Soester Eisenbahn 1855: „So wären denn die beiden alten, ehemals so berühmten Hansestädte [= Soest und Dortmund durch zwei Schienenwege, wovon der eine, der früher gebauten Bahn, über Hamm geht, verbunden. Möchten sich beide Städte wieder zu dem alten Glanze emporheben, den sie früher besaßen.“ Hellweger Anzeiger Nr. 58,21.7.1855, Über die Festlichkeit. Mit der „früher gebauten Bahn“ ist die Köln-Mindener Eisenbahn gemeint.
[64] StdA Werl, E 49 Nr. 23, BI. 111, Brief der Versammlung der Stadtverordneten, 2.8.1849; “ … Unglaublich klingt es zwar, dass man im Interesse der Stadt und des Amtes Hamm den Hellweg von der Eisenbahn ganz absperren will … „.
[65] Vgl. StdA Werl, Dep. Erbsälzer-Archiv, Sc VII 27 cl, S. 283f. 12. Collegial-Versammlung, Bericht Lilien-Borgs, 5.6.1851.
[66] StdA Soest, B XVI d 9, Denkschrift den Bau einer Eisenbahn von Dortmund nach Soest betreffend, Dortmund 1851. Auch vorhanden im StA Münster, Oberpräsidium 1152, BII. 51-53.
[67] StdA Soest B XVI d 7, dreiseitiger, undatierter Entwurf.
[68] Hellweger Anzeiger Nr. 76, 21.9.1853, Eröffnung der Arbeiten zum Bau der Dortmund-Soester Eisenbahn.
[69] Vgl. Hans Heinrich Blotevogel, Regionalbewusstsein. Bemerkungen zum Leitbegriff einer Tagung, in: Berichte zur deutschen Landeskunde, Bd. 60, H. 1, 1986, S. 103-114, hier S. 107. Peter Weichhart Die Region – Chimäre, Artefakt oder Strukturprinzip sozialer Systeme? In: Region und Regionsbildung in Europa: Konzeptionen der Forschung und empirische Befunde, hgg. v. Gerhard Brunn, Baden-Baden 1996, S. 25-43, hier S. 37. Thomas Küster, „Regionale Identität“ als Forschungsproblem. Konzepte und Methoden im Kontext der modernen Regionalgeschichte, in: Westfälische Forschungen 52, 2002, S. 1-44, hier S. 2 u. S. 19.