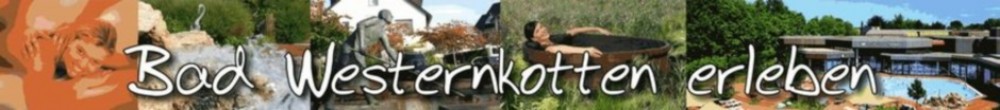von Maria Peters
Erstabdruck: Peters, Maria, Die 1. Wasserleitung in Westernkotten: in: Kreisheimatkalender 2007, S. 109-113; Zweitabdruck (etwas aktualisiert) in: Jahrbuch Bad Westernkotten 2010, Seite 44-49. Dort auch einige Fotos. WM
Bis in die dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts besaßen nur wenige Westernkötter Familien eine eigene Hauswasserversorgung durch Brunnen und Pumpen, weil beim Bohren meistens salzhaltiges Wasser gefordert wurde. Die Hausstätten-Besitzer, die somit kein genießbares Wasser auf ihren Grundstücken entnehmen konnten, mussten das kostbare Nass aus dem ,,Spring*, einer ergiebigen Quelle am östlichen Dorfrand, heranschaffen. Dies geschah teils mit einem zweirädrigen Handwagen und einer darauf befestigten Wassertonne, oder auch mit einem Tragejoch, das über Nacken und Schultern gelegt wurde. An den Ketten des Jochs wurden die gleichmäßig gefüllten Eimer vorsichtig nach Hause transportiert, meistens war dies Aufgabe der Frauen und größeren Kinder. Die Treffen am ,,Spring“ brachten sicherlich auch Abwechslung in den anstrengenden Frauenalltag.
Das saubere Quellenwasser, das so mühevoll herbeigeschafft werden musste, besaß natürlich einen großen Wert im täglichen Leben und dementsprechend sparsam wurde damit umgegangen. Für die Wäsche, zum Putzen und zum Trinken des Viehs nahm man das Wasser aus der ,,Bieke” — dem Osterbach — der das Dorf in Süd/ Nordrichtung durchfloss. Die morgendliche ,,Katzenwische“ fand an der Regentonne statt.
Bereits im Jahre 1911 wurde in einer Sitzung der Gemeindevertretung über den Anschluss Westernkottens an das für den Kreis Lippstadt geplante Lörmecke—Wasserleitungsprojekt beraten. Das erforderliche Trink- und Wirtschaftswasser wurde bis zu einer Menge von „55 Lt. täglich für je 1 Mensch, 1 Pferd oder Esel, 1 Stück Rindvieh, je 3 Schweine, Schafe oder Ziegen“ angenommen.
Das Projekt kam seinerzeit nicht zur Durchführung, nicht zuletzt wegen des Widerstandes der beteiligten Gemeinden, die befürchteten, dass die Lörmecke-Quellen in trockenen Sommern versiegten, wie eben im Sommer 1911 geschehen. Während des ersten Weltkriegs und in den Nachkriegsjahren ruhten die Pläne für eine zentrale Wasserversorgung.
Da 1926 in Westernkotten ein Paratyphus- und in Erwitte zwei Typhus-Fälle auftraten, von denen einer tödlich endete, erfolgten im Oktober 1926 die Wasseruntersuchungen mehrerer Brunnen und des Osterbachs, bei der ,,Coli-Bazillen“ nachgewiesen wurden. Besonders ein Brunnen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen war verseucht. Auszugsweise werden hier einige wichtige Aussagen des untersuchenden Instituts genannt: „…selbstverständlich ist der Genuss des Wassers aus einem solchen Brunnen auch für das Vieh (Seuchenverbreitung) zumindest zeitweilig mit Gefahren verbunden. (…) Das Wasser des Spring (= öffentlicher Brunnen am Ostrand des Dorfes) hat ein kristallklares Äußeres. Es ist indessen zufällig oder beabsichtigt Verunreinigungen ausgesetzt, ja bereits die Entnahme des Wassers mit nur äußerlich verschmutztem Eimer (Aufstell-Bodenrand) kann Schmutz u.a. Coli-Bazillen einschleppen. Es ist daher bei der Ubiquität der Coli-Bazillen in bäuerlichen Betrieben nicht weiter erstaunlich, dass der Spring am 8.10.1926 — trotz geringer Keimzahl und sonstiger günstiger Zusammensetzung — spärlich Coli-Bazillen enthielt.”
Im Jahre 1927 — wohl auch durch die verschärften Auflagen der Gesundheitsbehörden — machten sich die Gemeinden Erwitte und Westernkotten erneut Gedanken über die Anlage einer zentralen Wasserversorgung aus den vorhandenen eigenen Quellen. Verschiedene Wasserproben aus den beiden Gemeinden waren bereits dem Chem. Untersuchungsamt in Dortmund eingesandt worden. Am 20.12.1927 berichtete der Gemeindevorsteher Jesse anlässlich einer Gemeinderatssitzung über den Stand der Wasserversorgung der Haar-Dörfer.
In den Jahren 1928/1929 freundeten sich Erwitte und Westernkotten immer mehr mit dem Bau eines eigenen Wasserwerks an, da genügend ergiebige Quellen vorhanden waren.
Vorzugsweise wurde der Standort am Bullerloch wegen seiner Ergiebigkeit von 20 Litern/Sekunde angedacht (damaliger Bedarf für Erwitte und Westernkotten: je 5 Liter/Sekunde.). Ein Kostenvoranschlag über die Summe von 110.000 RM wurde für das Wasserleitungsprojekt in Westernkotten (ohne/mit Pumpwerk) vorgelegt. Trotz der Einwände des Preuß. Kulturbauamtes Lippstadt hielt der Gemeinderat an dem Plan der eigenen Wasserversorgung fest.
Am 24.1.1928 kam es anlässlich einer Ratssitzung beim Amt Erwitte zur vorläufigen Beschlussfassung über den Anschluss der Gemeinden Erwitte und Westernkotten an die Lörmecke-Wasserversorgung: „Gegengründe gegen die Lörmecke-Wasserversorgung seien in der Hauptsache die Bedenken, ob der Zeitpunkt für die Schaffung eines solchen großzügigen und kostspieligen Projekts angesichts der finanziellen Leistungsschwäche weiter Kreise der ländlichen Bevölkerung doch äußerst ungünstig gewählt sei. Weil das zur Untersuchung an das Chemische Untersuchungsamt der Stadt Dortmund entsandte Wasser aus den beiden Springen in Erwitte sowie dem Bullerloch, Muckenbruch und Lürteich in Westernkotten entnommene Wasser für einwandfrei befunden worden ist, diese Quellen auch von solcher Ergiebigkeit sind, dass der Wasserbedarf der Gemeinden Erwitte und Westernkotten hierdurch mehr als ausreichend gedeckt sein würde, habe es die Versammlung für zweckmäßig gehalten, in einigen Jahren dem Plane der Schaffung einer eigenen Wasserversorgungsanlage für Erwitte und Westernkotten unter Ausnutzung dieser Wasservorkommen näher zu treten.” Es wurde angemerkt, dass die letzte Ruhrepidemie in Erwitte nicht auf den Genuss von schlechtem Trinkwasser, sondern auf Ansteckung zurückgeführt wurde.
Es wurden weitere Gutachten über die Beschaffung des Wassers in Westernkotten eingeholt. Das Hygiene-Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster teilte am 7. Februar 1928 mit, dass die Lörmecke-Quellen die ergiebigsten Quellen sind, die für eine Wasserversorgung der Kreise Lippstadt und Soest zur Verfügung stehen. Die Temperatur der Lörmecke-¬Quelle betrage 15° C, bei einer Außen- Temperatur von 4,5° C. „Bakteriologisch verhielten sich die Proben außerordentlich günstig.“
Dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 2. April 1928 ist zu entnehmen: „Gegen die Wahl der Lörmecke-Quellen spielt zunächst die hohe Temperatur (15° C), die das Wasser einmal unschmackhaft und für die Milchkühlung im Sommer unbrauchbar macht. Dagegen die Quelle im Bullerloch – sowohl hinsichtlich der Qualität und Quantität des Wassers, wie auch hinsichtlich der Kostenfrage – bei der Anlage die einfachsten und günstigsten Bedingungen darbietet.“ Im Hinblick auf das bestehende Wasserrecht der Mühle am Osterbach in Westernkotten war vermerkt: „Sofern die Rechte der Mühlen-besitzerin Thiemann geschmälert werden, muss die Genannte hierfür angemessen entschädigt werden. „
Am 7. Mai 1928 wurde die Temperatur der Muckenbruch-Quelle mit 9,2° C angegeben, bei einer Wasserergiebigkeit von 1 Liter/Sekunde. Der Direktor des Instituts für Hygiene und Bakteriologie, Gelsenkirchen, schrieb: „Wenn man zwischen den Lörmecke-Quellen auf der einen Seite und den Bullerloch- und Muckenbruch¬-Quellen auf der anderen Seite einen Vergleich in hygienischer Beziehung ziehen will, so muss dieser – soweit wir das beurteilen können – zu Gunsten der Lörmecke-Quellen ausfallen, die bisher stets von gleichmäßiger Beschaffenheit gewesen sind und so den Anschluss an die Lörmecke-Quellen-Versorgung nur empfehlen können.“ Die von dem Institut durchgeführte Wasseruntersuchung der Bullerloch-Quelle am 9. Januar 1929 „ergab den Nachweis von Coli-Bazillen, wahrscheinlich durch tierischen Kot.“ Es wurde eine Fassung des Quellgebiets vorgeschrieben, damit keine Zuflüsse von anderen Stellen das Quellwasser verunreinigen. Die durchgeführte Untersuchung zeigte „ganz erheblich vermehrte Keimzahlen bis 11 000 in 1 ccm.“ Die Wassertemperatur dieser Quelle lag am 9. Januar 1929 – 2 Uhr mittags – bei 9° C.
Der für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung tätige Ingenieur Falter aus Münster, der für das Projekt in Westernkotten und Erwitte gewonnen werden konnte, teilte mit Schreiben vom 20. August 1932 dem Gemeindevorsteher Jesse mit: „Es ist anzunehmen, dass im Rahmen des von der Regierung aufgestellten Arbeitsprogramms auch größere Mittel für Wasserleitungsbauten freigestellt werden. Zweifellos werden die Gemeinden die besten Aussichten auf größere Zuschüsse haben, welche zur Wiederbelebung des Arbeitsmarktes sofort beitragen wollen.“
Im Gemeinderats-Protokoll vom 26. September 1932 steht vermerkt, dass ein Anschluss an die Lörmecke-Wasserversorgung für die Gemeinde Westernkotten nach wie vor nicht in Frage kommen könne, weil derselbe eine untragbare finanzielle Belastung für die Gemeinde bedeute. Dagegen sei die Wasserversorgung durch Ausnutzung der örtlichen Quellen (Muckenbruch) tragbar, wenn die Ausführung im Wege der Notstandsmaßnahmen erfolge und der Gemeinde Zuschüsse und verbilligte Darlehen aus Reichs-, Staats- und Provinzialmitteln bewilligt würden und somit die Gesamtwasserversorgung für Westernkotten nach den heutigen Preisen nur noch 70.000 RM koste. Einen Monat später heißt es im gleichen Gremium: „… ist es zunächst erforderlich, den Nachweis zu erbringen, das genügendes und einwandfreies Wasser für eine zentrale Wasserleitung in der Nähe des Dorfes vorhanden ist. Die bis jetzt in Aussicht genommenen Wasservorkommen seien nämlich nach dem beim Kulturbauamt und Städt. Bauamt in Lippstadt vorhandenen Unterlagen über die geologische Beschaffenheit doch wohl nicht geeignet.“ Dagegen schrieb am 25. Oktober 1932 der Ober-Ingenieur W. Henning aus Frankfurt/M. in seinem Gutachten: „Die dortige Gegend ließ einen außerordentlichen Wasserreichtum im Untergrund erkennen, unter den zahlreichen unterirdischen Wasserläufen befinden sich jedoch eine größere Anzahl mit salzhaltigem Wasser (Sole). Untersuchung der Bullerloch-Quelle ¬etwa 200 m oberhalb der Quelle, an der oberen Papenschen Grenze: Gegenwärtige Schüttung der Quelle soll 20 Ltr. / Sek. betragen. … so gibt die Quelle anscheinend z. Zt. nur einen kleinen Teil des von dem Wasserlauf mitgeführten Wassers und die Unversiegbarkeit – auch in den trockensten Perioden -legt den Gedanken nahe, dass es sich hier um ein eingangs erwähntes, aus der Tiefe aufsteigendes Wasser handelt. Dafür spricht auch der relativ geringe Bakteriengehalt in der mir zur Einsicht vorgelegten Analyse. Es treten zwar bei Regenperioden gelegentlich leichte Trübungen des Wassers auf, die aber vielleicht auf Verunreinigungen in nächster Umgebung der Quelle zurückgeführt werden können. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Versorgung Westernkottens mit Trinkwasser keinerlei Schwierigkeiten bereitet.“
Am 27. Oktober 1932 schreibt der Vorsitzende des Kreisausschusses Lippstadt an dem Bürgermeister zu Erwitte: „Die Gemeinde Westernkotten geht jedoch durchaus fehl, wenn sie annimmt, das Lörmecke-Wasserwerk sei bereits gescheitert.“ Am 29. November 1932 lädt der Bürgermeister aus Soest den Gemeindevorsteher Jesse zu einer Besprechung im engeren Kreis¬ das Lörmecke-Projekt betreffend – ein.
Der „Patriot“ bringt am 26. Januar 1933 in großer Aufmachung: „Das Lörmecke-Projekt marschiert. – Aufnahme einer großen Anleihe. ¬Stimmungsbild aus dem Kreistag.“ Hier wird nur sehr verkürzt der Inhalt der Kreistagssitzung wiedergegeben. „Im Mittelpunkt dieser Tagung stand ein eingehender Bericht des Herrn Landrats Dr. Frhr. Raitz von Frentz über die Finanzlage des Kreises und den Stand des Lörmecke-Projekts. …Besonderes Interesse erregten seine Ausführungen über den Stand des Lörmecke- Wasserversorgungsprojektes, das jetzt in ein neues, entscheidendes Stadium eingetreten ist, nachdem es aufgrund der in der vergangenen Woche in Berlin getätigten Verhandlungen gelungen ist, die Finanzierung des Millionenprojekts aus Mitteln des Reichsarbeitsbeschaffungsprogramms sicherzustellen. Der Kreis Lippstadt ging heute bereits den beiden anderen in Frage kommenden Kreisen Arnsberg und Soest mit gutem Beispiel voran und genehmigte grundsätzlich die Aufnahme einer Anleihe in Höhe von 861.568 Reichsmark. Im Interesse der Behebung der großen Arbeitslosigkeit und der unter Wassermangel leidenden Bevölkerung in den drei genannten Kreisen wäre es dringend zu wünschen, dass auch die Kreise Soest und Arnsberg baldigst den entsprechenden Beschluss fassen, damit im Frühjahr, nach Bildung des kommunalen Zweckverbandes, die Arbeiten in Angriff genommen werden können. Dadurch wäre es möglich, Hunderte von Arbeitslosen wieder in lohnende Arbeit zu bringen. … Der Kreistag hat, so führt der Landrat aus, im August 1931 den Beschluss gefasst, aus den drei Kreisen Lippstadt, Soest und Arnsberg einen Zweckverband zum Bau des Projektes zu bilden.“
Am 3. Oktober 1933 geht ein Schreiben des Kreisausschusses an die Gemeindevertretung von Westernkotten: … ersuche ich nunmehr, die Gemeindevertreter der Gemeinde Westernkotten aufzufordern, Stellung zu nehmen, zu dem Anschluss an das Lörmecke-Projekt. …, dass im Falle der Ablehnung, Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, da die Trinkwasserversorgung aus genanntem Grunde vom hygienischen Standpunkt aus höchst bedenklich und nur durch den Anschluss an das Lörmecke¬-Projekt die Möglichkeit einer besseren Wasser-versorgung gegeben ist. (u.) Den Kreisleiter der NSDAP habe ich gebeten, die der Partei angehörenden Gemeindevertreter von der Notwendigkeit eines Anschlusses an das Lörmecke-Projekt zu überzeugen.“
Anlässlich einer Gemeinderatssitzung vom 21. November 1933, an der auch der Landrat Flottmann, der Kreisphysikus Lehmkuhl und Amtsbürgermeister Maurer teilnahmen, wurde das Problem der Wasserversorgung eingehend beraten. Die geladenen Herren machten deutlich, dass wegen der schlechten Wasserverhältnisse in Westernkotten „von allen für den Anschluss vorgesehenen Gemeinden, am dringlichsten nötig“ ein Anschluss erforderlich sei. Am 19. Januar 1934 teilte der Landrat dem Gemeindevorsteher mit, dass bei einem Wasserpreis von 22 Reichspfennig pro cbm die Gemeinde jährlich 8.921 RM an Wassergeld zu zahlen habe.
Nach der Beratung am 20. Februar 1934 im Gemeinderat erklärt der Gemeindevorsteher, dass die Gemeinde Westernkotten mit fünf zu vier Stimmen – bei zwei Enthaltungen – den Anschluss an das Lörmecke-Wasserwerk beschlossen habe, „wobei darauf zu achten sei, dass bei den zu vergebenen Arbeiten möglichst viele (arbeitslose) Westernkötter eingesetzt würden.“ Ein Drittel der anfallenden Wasserkosten durfte nach Aussage des Landrats in den Gemeindeetat übernommen werden. Der außerhalb des Dorfes liegende Domhof und der Weringhoff würden einstweilen nicht an die Versorgung angeschlossen. Zu erwähnen sind noch die Worte des Gemeindevorstehers Pieper zu Beginn der Beschlussfassung: „Endlich müssen auch diejenigen, die für ihre Person gutes Wasser besitzen, im Interesse der Allgemeinheit Opfer bringen, insbesondere die Bauern. Gerade der Bauernstand, der von unserer Regierung planmäßig gefordert wird, darf sich aus eigennützigen Gründen nicht gegen eine Maßnahme der Regierung wenden, wenn dieselbe anderen Volksgenossen mehr zu gute kommen sollte, als ihm selbst. Aus den vorstehenden Gründen halte ich es trotz der großen Widerstände, die in der Gemeinde Westernkotten gegen den Anschluss an das Lörmecke-Wasserwerk bestehen, für eine Pflicht, diesen Anschluss namens der Gemeinde Westernkotten zu beantragen und hoffe zuversichtlich, dass dieser Beschluss der Gemeinde zum dauernden Segen gereichen wird.“ Zu dem Zeitpunkt zählte die Gemeinde 1.190 Einwohner. Außerdem wurden 798 Stück Großvieh und 1.515 Stück Kleinvieh gezählt. Der Wasserverbrauch wurde auf 111,1 cbm pro Tag geschätzt.
Im Gemeinderats-Protokoll vom 22. Juni 1934 ist zu lesen: „Gegen eine Polizeiverordnung über den Anschluss der bebauten Grundstücke an die Wasserleitung der Gemeinde sowie einer entsprechenden Ortssatzung über Benutzung, Betrieb und Unterhaltung der Wasserleitung in der Gemeinde werden keine Bedenken erhoben.“ Am 18. Januar 1935 kam es schließlich zum Vertragsabschluss über die Versorgung der Gemeinde Westernkotten mit einwandfreiem Trinkwasser durch das Lörmecke-Wasserwerk. „Der Vertrag läuft auf die Dauer von 40 Jahren (1.1.1935 – 31.3.1975).“ Unter dem 31. Mai 1935 wurde vermerkt, dass mit dem Lörmecke-Wasserwerk ein Vertrag abzuschließen sei, der eine Mindestwasserabnahme von 117,8 cbm tägl. – über 40 Jahre – vorsieht, bei einem Kubikmeter-Preis von 22 Reichspfennig.
Gut 70 Jahre sind seither vergangen und angesichts des aktuellen Wasserverbrauchs in unserem heutigen Heilbad mag manch einem der jahrelang währende Kampf um gutes Trinkwasser für die Gemeinde Westernkotten im Rückblick wie eine „Provinzposse“ anmuten: Sage und schreibe 283.000 cbm Wasser wurden im Jahre 2004 in unserem Stadtteil verbraucht. Es ist kaum anzunehmen, dass das „Bullerloch“ diesem Bedarf – und der ursprünglich angedachten zusätzlichen Versorgung Erwittes – dauerhaft hätte Rechnung tragen können, ganz abgesehen von den Qualitätsmaßstäben, die heute an unser kostbares Lebensmittel Trinkwasser gestellt werden. Die damalige Planung hat es zudem ermöglicht, dass der Osterbach, gespeist durch das Bullerloch, in heutiger Zeit zur Verschönerung des Bad Westernkötter Ortsbildes beiträgt.
Quellen:
- Stadtarchiv Erwitte C1, 1100-1106,
- Patriot Lippstadt, 26.1.1933
- Mitteilung Wolfgang Hasse, Lörmecke-Wasserwerk Erwitte 2005