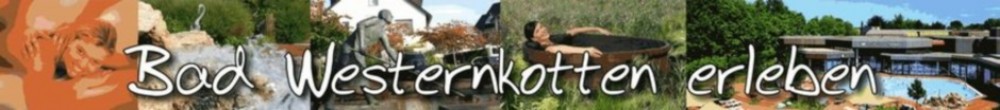Von Wolfgang Marcus
Fritz[1] Dietz, geboren am 16.06.1946 in Westernkotten, gestorben am 23.04.2018 in Erwitte[2], kenne ich schon fast seit meiner Jugend; auch als er später in Stirpe wohnte gab es immer wieder kurze Begegnungen. Vor allem kannte ich ihn als sog. Sondengänger. Der Sondengänger ist eine Person, die mit einem Metalldetektor gezielt nach Gegenständen im Boden sucht. Dieser Vorgang wird im Fachjargon unter Sondengängern gerne als sondeln bezeichnet. In Deutschland ist in allen Fällen eine Genehmigung der Grundeigentümer notwendig sowie die der Denkmalbehörde. Des Weiteren stellt sich die Eigentumsfrage an den Funden sowie das Problem der Zerstörung des archäologischen Kontextes. Erst die Berücksichtigung dieses sogenannten Befunds ermöglicht ein historisches Verständnis der Funde. Diese Zerstörung tritt allerdings in der Regel nur durch Raubgräber, sprich Sondengänger ohne Genehmigung auf, da es an Dokumentation mangelt. Außerdem bekommen Archäologen die Objekte, die von Raubgräbern entdeckt werden, nur sehr selten zu Gesicht. – Entwickelt wurden Metalldetektoren zum Auffinden von Landminen und Munition. Sie wurden von den Armeen in und nach dem Zweiten Weltkrieg im Kampfmittelräumdienst eingesetzt. Anfang der 1960er Jahre wurden in den USA ehemalige Minensuchgeräte von Privatleuten zum Auffinden von verloren gegangenen Wertgegenständen an Badestränden und zum Auffinden von Metallgegenständen in Geisterstädten sowie Schlachtfeldern des Bürgerkriegs benutzt. – Ab den 1960er Jahren wurden erste Metallsuchgeräte zum privaten Gebrauch, zur Schatzsuche (Treasure Hunting) hergestellt. – Die Schatzsuche hielt Anfang der 1970er Jahre Einzug in Europa und verbreitete sich von Großbritannien aus sehr schnell über den Kontinent. Man schätzt die Zahl der Sondengänger und Schatzsucher in Europa auf mehrere hunderttausend.
Fritz Dietz hatte auch eine sehr gute Verbindung zum Heimatverein Bad Westernkotten. So heißt es unter dem 20.5.2002: „Zum 9.Mal Teilnahme am Deutschen Mühlentag, mehr als 1000 Besucher. Besonderes Interesse findet auch die Präsentation von Fritz Dietz mit Funden aus den Wüstungen rund um Bad Westernkotten.“ – Diese Funde bzw. Repliken davon befinden sich im Archiv der Heimatfreunde Bad Westernkotten in der oberen Etage der Schäferkämper Wassermühle und sollen mittelfristig in einem kleinen Ausstellungsbereich im Umfeld der Hellweg-Sole-Thermen präsentiert werden.
Im Folgenden[3] sollen beispielhaft einige wichtige Funde von Fritz Dietz aufgelistet und kurz mit Zitaten aus archäologischen Fachzeitschriften vorgestellt werden[4].
2010: Bronzene Stützarmfibeln der Außenstelle Olpe übergeben
„Private Begehungen von archäologischen Fundstellen mit Metalldetektoren sind für die archäologische Denkmalpflege ein Schreckensszenario – solange die Sondengänger nicht mit den zuständigen Ämtern der LWL-Archäologie für Westfalen zusammenarbeiten und die Funde undokumentiert im Internet auftauchen oder in Vitrinen privater Sammler verschwinden. Für die Wissenschaft sind diese Kulturschätze dann unwiederbringlich verloren und werden als zusammenhanglose Objekte wertlos. – Anders stellt sich die Situation jedoch dar, wenn Sondengänger eng mit den zuständigen Ämtern für Bodendenkmalpflege in Kontakt stehen und ihre Funde unter möglichst exakter Angabe der jeweiligen Fundstelle vorlegen. – Eine derartig vorbildhafte Zusammenarbeit hat der LWL-Archäologie für Westfalen in ihren Außenstellen Münster, Bielefeld und Olpe eine Vielzahl von Funden beschert, die zum Teil sogar zur Lokalisierung neuer Fundplätze geführt haben. Die Funde selbst, von denen die hier vorgestellten bronzenen Stützarmfibeln nur eine von vielen Fundgruppen darstellen, lassen inzwischen ein völlig neues Bild der Frühgeschichte Westfalens erkennen… Im Jahr 2010 wurden der Außenstelle Olpe von den Sondengängern Fritz Dietz und Jan Koch zwei weitere dieser stabilen Stützarmfibeln aus dem Raum Erwitte vorgelegt.“

Abb. 1: Massive Stützarmfibeln mit Trapezfuß (links) und Varianten (rechts) aus dem Raum Erwitte. Das Exemplar oben links wurde in zwei Teile zerbrochen an verschiedenen Stellen gefunden; wieder zusammengesetzt besitzt es eine Länge von 5,2 cm und ein Gewicht von 32 g (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/S. Brentführer)

Abb. 2: Stützarmfibeln mit bandförmigem Bügel und Zwischenform (rechts unten) aus dem Raum Erwitte. Die kreisaugenverzierte Fibel (links unten) ist 3,2 cm lang und besitzt einen 4 cm breiten Stütz-Arm, Gewicht 15 g (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/S. Brentführer)
„…Sieben weitere Neufunde von Stützarmfibeln, davon sechs aus Erwitte, die 2010 von den bereits genannten Sondengängern Dietz und Koch sowie Ludwig Ruf mit exakten Fundortangaben vorgelegt wurden, und eine aus Kamen-Westick, Kreis Unna, die Ulli Neumann gemeldet hat, sind als Varianten und Weiterentwicklungen der bisher genannten Exemplare zu bezeichnen. Sie sind kleiner, weniger massiv und schwer, besitzen einen Trapezfuß und haben zum Teil einen flachen bandförmigen Bügel. Horst Wolfgang Böhme hat solche Typen in seiner grundlegenden Publikation von 1974 der sächsischen Frauentracht zugerechnet und aufgrund ihres Verbreitungsschwerpunkts »Stützarmfibeln vom Niedersächsischen Typ« genannt, eine Bezeichnung, die angesichts der zunehmenden Zahl in Westfalen zumindest überdacht werden sollte. – Die Fundstücke der Sondengänger tragen dazu bei, den gerade für die Völkerwanderungszeit relativ unbekannten Raum Westfalen nach und nach zu erhellen… Die Fundverteilung scheint anzudeuten, dass die westfälischen Regionen entlang des Hellwegs und der großen Wasserstraßen wie Lippe und Weser bevorzugt von solchen Personen besiedelt waren oder zumindest begangen wurden, die wie auch viele Sachsen als Söldner in römischen Diensten standen…“[5]
2006: Blei aus der römischen Kaiserzeit gefunden
„…Die Verarbeitung des Bleis – Es bleibt die Frage offen, wozu die in Soest ansässige Bevölkerung das Blei verwendet hat. Bestand vor Ort ein Eigenbedarf für Blei? Für wen wurde es weiterverarbeitet? Kann ein Handel mit dem Römischen Imperium oder mit anderen Gebieten der Germania magna postuliert werden? Chr. Grünewald hat gezeigt, dass das Münsterland, abgesehen vom Bleiring aus Albersloh, in der älteren römischen Kaiserzeit bleifrei war. 20 Auch das westlich der Bördelandschaft bis zum Rhein liegende Gebiet zeigt bisher für die ältere römische Kaiserzeit keine Funde. Lediglich im Bereich des Hellweges südlich der Lippe, insbesondere im Bereich des Austritthorizontes der Salzquellen am nördlichen Rand des Mittelgebirges, also etwa zwischen Werl und Bad Lippspringe, gibt es nach heutigem Kenntnisstand vermehrt Fundplätze der römischen Kaiserzeit mit Bleiobjekten und Gussresten. Von verschiedenen Fundstellen gerade aus Werl, Erwitte, Geseke und Paderborn ist in den letzten Jahren eine Vielzahl von Bleiresten durch Detektorgänger gesammelt worden, allerdings ohne dass eine zeitliche Ansprache der Objekte bisher möglich war. Bei den meisten der „spinnwirtelartigen“ Objekte handelt es sich dabei ebenfalls um Gussreste. – Eine Begutachtung ca. 100 „wirtelartiger“ Objekte aus Erwitte-Bad Westernkotten wurde den Verfassern dankenswerterweise durch den Sammler Herrn Fritz Dietz gewährt. Es handelt sich eindeutig um Gussreste aus dem Bereich von Gusstrichtern und nicht um Spinnwirtel.“[6]
2002: Keltische Eberstatue aus Bronze gefunden
„Wie aufregend Archäologie sein kann, beweist die kleine, beschädigte Eberstatue aus Bronze, die im Jahre 2002 Fritz Dietz im Raum Erwitte (Kreis Soest) gefunden hatte (siehe Neujahrs-Gruß 2003, S. 123[7]). Die fehlende Rückenpartie hat zahlreiche Diskussionen über das Gesamtbild des Tierfigürchens ausgelöst, die dann zu einem ersten Rekonstruktionsversuch führten. Dass Vergleiche von Fundmaterial aufgrund von stilistischen Kriterien nicht immer zutreffend sein müssen, zeigt der neue Fund von Fritz Dietz (siehe Abbildung). Etwa 5 m von der Fundstelle der Eberstatue entfernt entdeckte er nämlich das fehlende Rückenteil mit dem vollständig erhaltenen Kamm, der wider Erwarten nicht massiv, sondern durchbrochen gestaltet ist. Eine erste Überprüfung des Fundes, der noch bis Februar 2006 in der Landesaustellung im Museum in Herne zu besichtigen ist, deutet nach Aussage unserer Restauratorin auf einige technische Überraschungen hin (R. Tegethoff).“

Abb. 3: Raum Erwitte. Der schon vor zwei Jahren entdeckte keltische Bronzeeber konnte jetzt mit dem durchbrochenen Rückenkamm ergänzt werden. Foto: WMfA / S. Brentführer.
2007: Hochmittelalterliche Scheibenfibel geborgen
„Von den hochmittelalterlichen Scheibenfibeln sei ein gut erhaltenes, aufwendig verziertes Exemplar aus dem Raum Erwitte (Kreis Soest) hervorgehoben, das Fritz Dietz (Erwitte) geborgen hat. Die Fibel hat fünf kreuzförmig angeordnete, quadratische Einfassungen mit kugeligen Glaseinlagen…“

Abb. 4: Raum Erwitte, hochmittelalterliche Scheibenfibel. Fotos/Bearbeitung: LWL/H. Menne und A. Müller.
[1] Eingetragener Geburtsname: Friedrich Wilhelm
[2] Herzlichen Dank für einige biographische Angaben an seine Tochter Ulrike.
[3] Vgl. auch meinen Aufsatz „Bronzeskulptur eines keltischen Ebers – Erinnerungen an Sondengänger Fritz Dietz.
Einer der größten Funde in Westfalen; https://www.wolfgangmarcus.de/aufsaetze-2025/2025-bronzeskulptur-eines-keltischen-ebers-einer-der-groessten-funde-in-westfalen-erinnerungen-an-sondengaenger-fritz-dietz/
[4] Meine wichtigste Quelle waren Angaben des LWL-Amtes Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, dort vor allem der jährliche „Neujahrs-Gruß“ (für das Vorjahr).
[5] LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe; Brieske, 2010
[6] Soester Beiträge zur Archäologie 8: Bleibergbau und Bleiverarbeitung während der römischen Kaiserzeit
im rechtsrheinischen Barbaricum, S. 97
[7] Neujahrs-Gruß 2006, S. 65/66