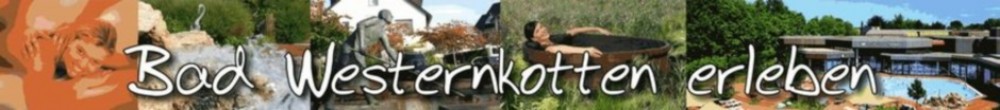Wolfgang Marcus
Man soll ja ab und zu seine Sachen in der Wohnung einmal aufräumen, durchforsten, sichten und wegwerfen, was nicht mehr nötig ist. Letztlich sagt der Volksmund ja: Das letzte Hemd hat keine Taschen. In den letzten Tagen habe ich mein Hängeregister „Volkskundliches“ gesichtet, die wertvolleren Texte gesichert, geordnet und in unsere Schrift übertragen. Herausgekommen ist folgender Aufsatz, den ich an einigen Stellen noch mit Angaben von Maria Peters in ihrem Artikel „Brauchtum im Jahreskreis“ [1] ergänzt habe.
- Brauchtum im Jahreskreis
Silvester/Neujahr
Das alte Jahr endet bekanntlich mit dem 31. Dezember, dem Namensfest des Heiligen Sylvester, und dann beginnt das neue Jahr mit dem Neujahrstag, dem 1. Januar. Maria Peters schreibt dazu:
Unsere Vorfahren begrüßten das Neue Jahr mit der gleichen Freude wie wir heute. Allerdings ging es nicht so laut zu, denn Raketen, Böller und Knaller kannte man noch nicht. Der Silvesterabend gehörte vor allem den jungen Burschen, die von Hof zu Hof zogen, um Würste zu sammeln. Dabei sangen sie das beliebte Lied: „Hessa Viktoria, ein glückseliges Neues Jahr! Nun steht doch mal auf und schaut heraus und werft uns eine Mettwurst ‚raus! Hessa Viktoria, ein glückseliges Neues Jahr!“ – Manches Kammerfenster wurde geöffnet, und ein junges Mädchen oder auch vielleicht die Braut eines der Sänger warf eine schöne Wurst heraus. Der Hausherr spendierte einen Schnaps, und weiter gings zum nächsten Hof. – Die Würste wurden auf einer langen Stange gesammelt und ab ging’s zum Wirtshaus Besting, Dietzen oder Kempers — wo sie gebraten wurden. Den Rest der Nacht verbrachte man beim Kartenspiel; Doppelkopp oder Schafskopp, wobei es oft laut und heftig zuging. Es kam auch mal vor, dass sie sich dabei „an de Hörner kriegen.“ – Die Mädchen und Frauen waren bis etwa in die 1950er Jahre nicht an den Wirthaus-Silvesterfeiern beteiligt. Sie hatten das Haus zu hüten und zu warten, bis die Männer — meistens erst in der Morgenzeit — nach Hause kamen und den Daheimgebliebenen ein „glückseliges Neues Jahr“ wünschten. – Dieser Gruß wurde auch im Laufe des Neujahrstages, besonders nach den Heiligen Messen, allen Nachbarn und Freunden zugerufen. – Später — etwa nach 1950 — feierten die Frauen in den sog. Vereinslokalen den Silvesterabend mit. Auch wurde es allmählich üblich, dass mehrere befreundete oder verwandte Familien sich zusammentaten, um zu Hause im größeren Kreise Sylvester zu feiern. – Briefträger und Zeitungsboten hatten einen Grund, sich auf Neujahr zu freuen. In den meisten Häusern bekamen sie ihr „Nijöerken“, ein Geldstück oder ein Schnäpschen. – Auch war in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts das Neujahrskartenschreiben groß in Mode. Es wurden Jux-Karten oder Karten mit Glückssymbolen an Verwandte oder Bekannte geschickt, die nicht im Ort wohnten und denen man für das kommende Jahr alles Gute wünschte.
Dreikönigs-Tag
Die Sternsingeraktion wurde in Bad Westernkotten erstmals am 6.1.1975 durchgeführt, und zwar durch den Jungpfadfindertrupp “Baden-Powell” unter der Leitung von Hans-Jürgen Marcus. Bis dahin beteiligten sich aus der näheren Umgebung nur die kath. Kirchengemeinden Anröchte, Benninghausen, Hellinghausen und Lippstadt St. Josef an dieser gemeinsam vom Päpstlichen Missionswerk der Kinder in Aachen und dem BDKJ Paderborn durchgeführten Aktion.[2]
Der 6. Januar ist der Dreikönigstag (auch Heilige Drei Könige oder Epiphanias), das Fest der Erscheinung des Herrn, an dem an den Besuch der Weisen aus dem Morgenland bei Jesus erinnert wird. In Deutschland ist der 6. Januar nur in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ein gesetzlicher Feiertag. Traditionell ziehen Kinder als Sternsinger von Haus zu Haus, um Lieder zu singen und Segen zu bringen. – Das ist auch in Bad Westernkotten mindestens seit mehr als 50 Jahren der Fall.
Das nachfolgende Lied ist ein Nettelstädter[3] Dreikönigslied und wurde von Maria Schöneweiß und Heinrich Schütte-Wördehoff in Kopie beim Heimatverein abgegeben.
Dreikönigs-Lied (Hochdeutsch)
Wir heiligen drei Könige mit unserm Stern
Wir gehen mit den Stöcken und suchen den Herrn.
Lass schneien und regnen, das tut uns nichts
Wir halten uns munter, tapfer und fix.
Und wann wir sollen unsere Namen euch sagen,
Dann werdet Ihr alle Respekt für uns haben
Ich, Melchior, ich bin so fein, so fein
wie mancher Graf kann sein.
Bin fein gewaschen und fein gekämmt.
Ist alles auf das Beste bestellt.
Ich, Käsperken, ich bin nicht weiß.
Den schönen Jungfrauen gefall ich nicht.
Und wenn Ihr mich bei Nacht ansehet (beguckt),
Dann bin ich ganz den Euren gleich.
Ich, Baltasar, ich bummele so mit
Ich bin nicht eisig und nicht nett
Ich bummele so hinter den anderen her
Will auch mit ins Heilige Land.
Das Heilige Land das ist so weit
Da hat man öfter mal Appetit.
Das Geld kann man nicht von Zäunen abbrechen
Da muss man schon ehrliche Leute ansprechen
Sie bitten um eine Gabe…
Ihr habt uns ein Geschenk gegeben,
Nun sollt Ihr auch in Frieden leben
In Frieden und in Einigkeit, von nun an bis in Ewigkeit!
Karneval
Als im Jahre 1881 bei Karnevalsstreitereien ein Bauer bei Schrops Kreuz erschlagen wurde, führt man wenig später ein 40stündiges Gebet ein, dass die ständigen Unruhen beendete. Im kirchlichen Raum erinnerte bis in die 1990er Jahre eine (!) Gebetsstunde am Sonntag vor Aschermittwoch daran. Im außerkirchlichen Bereich gabt es vereinzelt noch deutliche Erinnerungen. So war es bei der Firma „Rollladen und Fenster Schäfermeier“ üblich, dass am Montag und Dienstag vor Aschermittwoch nicht gearbeitet wurde, ursprünglich, um allen Betriebsangehörigen Gelegenheit zum häufigen Besuch der Gebetsstunden zu geben.[4]
In den Akten war ein Zettel mit Liedtexten von Heinrich Konieczny, die ich bereits einmal veröffentlicht habe.[5] Deswegen hier nur einer der genannten Liedtexte:
Eins, zwei, drei, bist du. verliebt, verlobt, verheiratet.
Eins, zwei, drei, ist deine Jugendzeit vorbei.
Wer immer nüchtern ist,
und immer schüchtern ist,
der hat bestimmt noch nie geliebt und nicht geküsst.
Blick mal ins Mädchenauge richtig rein,
dann wirst du bald verliebt, verlobt, verheiratet sein.
Lobetag
Der Westernkötter Lobetag ist das bedeutsamste Fest im Jahreskreis. Viele der gefundenen Texte stammen von Heinrich Ferdinands.[6] Hier ein Gedicht, das später vom ersten Dirigenten des Männergesangvereins Westernkotten, Heinrich Busch, vertont wurde.[7]
Marienlied zur Dreihundertjahrfeier in Westernkotten
Gegrüßt seist du, Maria, du Himmelskönigin,
wir kommen dich zu ehren mit demutvollem Sinn.
Und wer da hat ein Leiden, und wer da fühlt ein Weh,
fass’ kindliches Vertrauen, und zu Maria geh:
O breite deinen Mantel aus und hilf uns aus der Not!
Vor langen, langen Jahren zog Krieg und Pest durchs Land,
der Tod, er schwang die Sichel, mit rauer Henkershand.
Marias Kinder eilten, von Not bedrängt, herbei,
bestürmten dann den Himmel mit ihrem Bittgeschrei:
O breite deinen Mantel aus und hilf uns aus der Not!
Und wenn in unseren Tagen bedrückt uns Seelennot,
wenn starke Stürme brausen, des Glaubens Licht bedroht,
dann eilet zu Maria, die schnell und hilfsbereit:
Erhöre unsre Bitten, jetzt und in Ewigkeit!
O breite deinen Mantel aus und hilf uns aus der Not!
Wenn in der letzten Stunde uns kalter Schweiß umweht,
zerreißt der Lebensfaden, der Zeiger stille steht,
dann stärke uns, Maria, und bitt’ für uns bei Gott.
Dann reich’ uns deine Hände — wie bitter ist der Tod —
Dann breite deinen Mantel aus und hilf uns in der Not!
Anmerkungen: Dieses Lobetags-Gedicht des bekannten Bad Westernkötter Heimatdichters Heinrich Ferdinands (1866- 1947) ist paarig gereimt; als Versmaß ist ein Alexandriner vorzufinden, eine jambische Reimform mit deutlichem Einschnitt nach der 3. Hebung. Diese Versform wurde zum Beispiel in Barocksonetten häufig verwendet, die oft christliche Themen und Inhalte ansprechen. Dieser „barocke Einschlag‘“ wird nochmals unterstrichen durch Bilder wie „Lebensfaden“ und „Lebensuhr“ in der letzten Strophe. Zum Aufbau: Nach der Begrüßung Mariens wird an die Pestzeit erinnert, um dann Marias Hilfe auch heute und besonders in der Stunde des Todes herauszustellen.
Kräuterweihe
Die Kräuterweihe ist ein katholischer Brauch, bei dem am 15. August (Mariä Himmelfahrt) Kräutersträuße gesegnet werden, die aus Heilkräutern, Blumen und Getreideähren bestehen. Der Brauch geht vermutlich auf die Legende zurück, dass das leere Grab der Gottesmutter Maria nach ihrem Tod nach Kräutern duftete, und soll den geweihten Kräutern besondere Heil- und Schutzwirkungen verleihen. Die geweihten Kräuter werden dann zu Hause aufgehängt, bei Gewittern verbrannt oder bei Krankheiten verwendet.
In Bad Westernkotten wird dieser Brauch seit den 1980er Jahren durch die Heimatfreunde Bad Westernkotten, insbesondere Annemarie Schröder, gepflegt. Vor einigen Jahren wurde ein Handzettel verteilt, der die Situation anschaulich beschreibt. Hier der Text:
Die Anzahl der Kräuter unterscheidet sich von Dorf zu Dorf. In Bad Westernkotten haben wir sehr unterschiedliche Boden auf denen dann auch je nach Bodenbeschaffenheit unterschiedliche Pflanzen wachsen. So haben wir im Muckenbruch feuchte Böden, Richtung B1 Kalkböden und ansonsten Lössboden.
Welche Kräuter fürs Krautbund wachsen wo?
- Muckenbruch: Dost, Blutweiderich, Goldraute (Giärle Stärte), Pfefferminze, Weidenröschen, Mädesüß (Unser-Hergotts-Bettstroh)
- Straße nach Bökenförde: kleiner Alant, Sauerampfer, Spitzwegerich, Schafgarbe, Kamille, Rainfarn
- Das Lippische: Labkraut klein (Unserer-lieben-Frau-Bettstroh) und Mädel Süß (Unserm-Herrgotts-Bettstroh), Pfefferminze, Zinnkraut (Ackerschachtelhalm)
- Richtung Dahlhoff bzw. Patriot: Wilde Möhre (Herz Jesu Blut), großer Alant, Schafgarbe, Spitzwegerich, Rainfarn (Wiesenknopf), Goldraute, kleiner Alant, Jacobs-Kreuz-Kraut, Beifuß
- Straße Lippstadt nach BWK: kleiner Alant, Baldrian, Schafgarbe, Natternkopf, Rainfarn
- Wemberweg bzw. Straße BWK nach Erwitte: Johanniskraut, Natternkopf, große Königskerze, Jacobs-Kreuz-Kraut, kleiner Alant, wilde Möhre, Schafgarbe
- Pflaumenweg: kleine Königskerze (Odermennig), Eisenkraut
- westlich von BWK: Leinkraut, Wilde Möhre, Spitzwegerich
- wenig vorhanden: Wermut (Würmeu)
- Können wir nicht mehr finden: Osterluzei, Tausendgüldenkraut, Teufelsanbiss
- Aus dem Garten: Salbei, Dreißig Silberlinge, evtl. Pfefferminze, Donnerkraut, Thymian
- Als Schmuck: Dahlien und Astern
II. Weihnachten
Willi Mues schreibt dazu folgenden Artikel in den Erwitter Heimatnachrichten[8], der sich allerdings mehr auf die konkreten Erlebnisse des Kriegsjahres 1944 bezieht: Weihnachten vor 50 Jahren – Trotz Krieg und Not und Elend war es auch im sechsten Kriegsjahr wieder Weihnachten geworden und
die Menschen sehnten sich schon Iänger nach einer anderen und friedlicheren Welt als der in der sie gerade leben mussten.
Nach der geglückten Invasion in Frankreich hatte sich im Jahre 1944 die Tätigkeit der alliierten Flieger auch mehr und mehr auf die ländlichen Bereiche ausgedehnt.
So war im September eine Warnung an die Bevölkerung ergangen, sich vor Tieffliegerbeschuss zu
schützen. Im Oktober erschien eine Verordnung, nach der auch Taschenlampen bei Beginn der Dunkelheit abgeblendet sein mussten. Den Kindern war das Drachensteigenlassen aus militärischen Gründen bei hohen Strafen verboten worden. – Am 19. Oktober erging im gesamten Reichsgebiet der Aufruf zur Bildung des Volkssturms. Auf der Reichschulungsburg in Erwitte wurden spez. Ausbildungslehrgänge für Volkssturm-Angehörige gehalten, die teilweise später im sog. “Freikorps Sauerland” zusammengefasst wurden. Im Oktober wurde in der Weide zwischen der VEW und
der Fa. Menke ein Sendemast, der sog. Sender “Berta“ installiert, der Luftwarndienst-Funktionen ausübte.
Die zunehmende Härte des Krieges hatte sich auch in Erwitte in von Jahr zu Jahr steigenden Zahlen in gefallenen Soldaten abgezeichnet. Im Jahre 1940 war einer gefallen; 1941 = 16; 1942 = 12; 1943 = 32; 1944 =41, Die Zahl sollte im Jahre 1945 auf 58 steigen.
In den Schulen fiel nun auch öfter der Unterricht wegen Fliegeralarm aus und im Spätherbst auch wegen Mangel an Heizmaterial. Der Erlös der Heilkräutersammlung durch die Kinder der Volksschule hatte allein im Jahre 1944 einen Betrag von 1100 Reichsmark erbracht. Und es wurde weiterhin alles Mögliche gesammelt und wiederverwertet. – Die Versorgungslage erreichte in allen Bereichen einen absoluten Tiefpunkt. Kartoffeln gab es nur noch zeitweise auf besonderen Kartoffelbezugsscheinen.
Andere Nahrungsmittel nur auf entspr. Punkte der Nährmittelkarte, wenn vorhanden. Als Brennmaterial gab es nur noch Schlammkohle. – Glücklich wer noch andere Holzabfälle von Kisten und Obstbäumen oder alten Weidenästen dazu verheizen konnte. Aus spärlichen Mehl-, Zucker- und Fettbeständen wurde zu Weihnachten zu Hause gebacken, wenn man konnte.
Wer mit besonderer Genehmigung ein kleines Schwein schlachten konnte, war auch noch besser dran als viele andere Mitbürger. Wir gehörten zu den “Glücklichen” und die beiden alten Leute aus Dortmund, die bei uns als Evakuierte wohnten, bekamen auch etwas davon ab, wie auch andere Leute, mit denen wir Kontakte hatten; dafür sorgte unsere Mutter. – Der Mann war 1870 in Erwitte geboren und die Frau 1873 in Robringhausen. Nach der Heirat waren beide nach Dortmund gezogen und hatten im Jahre 1943 ihre Wohnung durch einen Bombenangriff eingebüßt.
Am Abend des 5. Dezember erlebte Soest einen schweren Bombenangriff, der das alte Stadtzentrum weitgehend zerstörte. Die Bombenverbände flogen bis in die Gegend von Erwitte und drehten dann nach Norden und Nordwesten ab. Es war ein so starkes Gedröhn, dass man nicht schlafen konnte. Die Feuerwehren aus der gesamten Gegend wurden zum Retten und Löschen dorthin beordert. Mancher hat in der Nacht auch hier wohl seinen Keller aufgesucht, der ihm aber im Ernstfall wenig Schutz bieten konnte.
So kamen die Weihnachtstage heran und wir, d. h. mein kleinerer Bruder und ich freuten uns auf das Christkind. – Was wohl bringen würde, trotz der ärmlichen Zeitverhältnisse. – Ich war seit einigen Wochen Messdiener und hatte auch wohl zu Weihnachten in den versch. Gottesdiensten meinen Dienst zu versehen. – Es war nur noch ein spärliches Geläut von einer Glocke, die zur Kirche rief, die anderen waren schon 1942 als kriegswichtiges Material abgeliefert worden. – Auch die Beleuchtung war in der altehrwürdigen Kirche recht spärlich. In der Kirche war in der damaligen Schmerzenskapelle (der heutigen Marienkapelle) die alte große Krippe, die nunmehr rund 100 Jahre alt ist, aufgebaut, – Sie war für alle Kinder jedes Jahr zu Weihnachten ein besonderer Anziehungspunkt, da nicht in allen Familien eine eigene Hauskrippe vorhanden war.
Sitten im Lebenslauf
Bauer und Heimatforscher Heinrich Eickmann hat etwa 1951 bei einer Veranstaltung des damals gegründeten Heimatvereins folgende Ansprache gehalten[9]: Unser Heimatverein ist noch jung, aber dass ein Interesse für die Aufgaben des Heimatvereins besteht, sieht man an dem guten Besuch dieser Veranstaltung. Der Heimatverein will die Geschichte des Dorfes erforschen und alles, was aus alten Urkunden, Büchern und Zeitungen vorliegt, sammeln und ordnen. Wertvoll ist dabei auch die mündliche Überlieferung, das, was die älteren Leute aus ihrer Jugendzeit noch wissen und was sie von ihren Vorfahren gehört haben.
Bei allen wichtigen Begebenheiten im Leben gibt es so viele Sitten und Gebräuche, die wir schriftlich niederlegen müssen, wenn nicht viel altes Kulturgut in Vergessenheit geraten soll. Bei Taufe, Hochzeit, Tod und auch bei vielen anderen Gelegenheiten finden wir viel altes Brauchtum. Die älteren Leute unter uns kennen noch die großen Pane-Krengels und die runden Kuchen, Konfekt genannt. Ich sah mal einen alten Mann den Krengel stolz auf den Spazierstock auf dem Rücken tragend.
Bei der Hochzeit ist zu nennen der Polterabend, der heute allerdings ausartet, was schade ist, denn dadurch sind schon viele alte Gebräuche untergegangen. Zur Tür Schleier ablegen und so weiter.
Bei Todesfällen sagt ein Nachbar der Verwandtschaft und den übrigen Nachbarn den Tod an. Sogar den Haustieren und besonders auch den eigenen wird der Tod des Herrn angesagt. Vor der Beerdigung wird der Sarg auf der Tenne noch einmal niedergesetzt und drei Vaterunser für den Verstorbenen gebetet. Auf der Deele hat er als Kind gespielt, später die Garben hochgestellt und früher auch die Garben gedroschen, nun wird der Tote selber wie ein Weizenkorn der Erde anvertraut, und zwar auch wieder durch die Nachbarn.
Darum verstehen wir auch, wenn die Frau Althoff in dem gleich folgenden Theaterstück sagt „Vor hundert Jahren wohnten unsere Familien noch zusammen und haben sich in Not und Tod beigestanden, und das soll nicht mehr wahr sein? [10]
Auf Bartholomäus wurde Butter gekirnt, davon wurde ein Teil ungesalzen in ein Töpfchen geknetet und das ganze Jahr hindurch als Salbe gebraucht. All diese alten Gebräuche müssen gesammelt und aufgezeichnet und damit für die Nachkommen erhalten werden.
[1] Im Heimatbuch von 1987
[2] Nach Informationen, Zeitschrift für kirchliche Jugendarbeit im Erzbistum Paderborn 1974, S. 135ff
[3] Nettelstädt ist ein Stadtteil von Rüthen.
[4] Mitteilung von Heinz Lehmenkühler am 11.2.1988
[5] Vgl. https://www.wolfgangmarcus.de/aufsaetze-ab-2000/aufsaetze-2007/2007-lieder-zum-karneval-in-bad-westernkotten-vom-maennergesangverein/
[6] Vgl. meinen Aufsatz Marcus, Wolfgang, Heinrich Ferdinands, ein Westernkötter Heimatdichter, in: Vertell mui watt Nr.205-217 (2003), darin auch 4 Gedichte von Ferdinands (Die Friedhofslinde in Westernkotten; Das Zehnthaus; En Luaf op de Küörter Priumen und In Günnewigs Garten). Siehe unter: https://www.wolfgangmarcus.de/aufsaetze-ab-2000/aufsaetze-2003/heimatdichter-heinrich-ferdinands/
Heinrich Ferdinands wurde am 11.1.1866 in Lippstadt geboren. Als Drahtzieher fand er Arbeit auf der Westfälischen Union im Lippstädter Süden. Wahrscheinlich nach seiner Hochzeit mit einem Mädchen aus dem Haus Könighaus aus Weckinghausen kaufte er in Westernkotten ein Haus an der Bruchstraße, heute Haus Nummer 25. Das Haus hatte den Hausstättenname „Hangebuils“. Zum Haus gehörte ein wunderschöner Garten mit alten Pflaumenbäumen und einer Weißdornhecke. Das Grundstück reichte bis an den Ostwall. – Das Ehepaar Ferdinands hatte keine Kinder. Frau Ferdinands geborene Könighaus verstarb früh, so dass ihr Mann viele Jahre Witwer war. Er zog in seinen letzten Lebensjahren nach Paderborn, wo seine Nichte Else Starke mit einem Rechtsanwalt verheiratet war. Schon früh war er Invalide geworden – der rechte Daumen war ihm abgerissen worden, wahrscheinlich bei seinem Beruf als Drahtzieher. Als Invalide musste er unter anderem längere Zeit am Abzweig der Weihe von der Gieseler („Überflut“) aufpassen, dass die Union genug Wasser für den Betrieb bekam. Er war seit der Gründung 1905 Vorsitzender des katholischen Arbeitervereins Westernkotten und hatte dieses Amt mindestens bis 1920 inne. Lange Jahre war er auch im Gemeinderat von Westernkotten tätig. Heinrich Ferdinands starb am 9.1.1947. Seinem Wunsch gemäß wurde er „in heimischer Erde in Westernkotten“ beigesetzt. Sein Gedicht „Das Westernkötter Spring“ stand in der Tageszeitung „Der Patriot“ vom 26.01.1928, vgl. https://www.wolfgangmarcus.de/einzelne-aufsaetze/aufsaetze-1603-1940/1928-o-v-wahrscheinlich-heinrich-ferdinands-wm-das-westernkoetter-spring-in-der-patriot-vom-26-01-1928/
[7] Es entstand 1935, eine Abschrift stammt aus dem Nachlass Wilhelm Probst
[8] Nr. 53, Dezember 1994
[9] Aus dem Nachlass Eickmann, Nr. 9
[10] In dem Text von Eickmann sind diese Worte auf Plattdeutsch geschrieben.