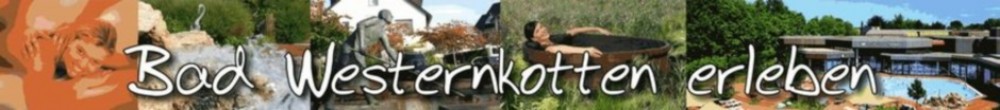[Wahrscheinlich wurde der Text vom damaligen Stadtarchivar Hans Peter Busch angelegt. Er lag mir als 4-seitiges Faltblatt vor. Vorab ein Teil der Titelseite. WM]
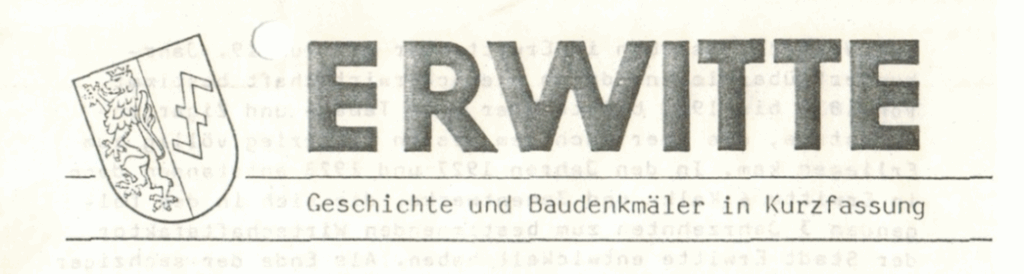
Erwitte gehört zu den frühest bezeugten deutschen Orten. Es ist eine vorfränkische Siedlung, in der Jahrhunderte hindurch der germanische Stamm der Brukterer ansässig war. Diese wurden im Jahre 695 von den Sachsen unterworfen. Diese konnten sich des eroberten Besitzes aber nicht lange erfreuen, denn der Frankenkönig Karl, der spätere Kaiser Karl der Große, eroberte schon 80 Jahre später das Land der Sachsen und führte es dem christlichen Glauben zu.
Durch den von Karl dem Großen um 784 in Erwitte errichteten Königshof, der „curtis regia Arvita“ trat Erwitte in die Geschichte ein. Urkundlich wurde der Ort jedoch erst um 836 in den Corveyer Traditionen erwähnt. Der durch Erwitte führende alte Hellweg diente schon in römischer Zeit als Hauptverkehrsweg. Erwitte war wiederholt Aufenthaltsort deutscher Kaiser und Könige. Im Staatsarchiv zu Münster werden die Urkunden aufbewahrt, die die Könige Heinrich I und II, 0tto II und III mit eigener Hand unterzeichneten, als sie auf dem Königshof zu Erwitte weilten.
Erwitte war Jahrhunderte hindurch Sitz berühmter Adelsgeschlechter. So waren hier ansässig die Ritter von Erwitte, die Grafen von Landsberg, die Freiherren von Droste, die Freiherren von Hoerde und die Herren von Bredenoll.
Im Mittelalter war Erwitte Sitz eines kurfürstlichen Gogerichtes und eines Freistuhl- und Femgerichtes. Zum Gogericht Erwitte gehörten zeitweise mehr als 100 Orte, unter ihnen auch die Stadt Lippstadt. Im Jahre 1936 veranstaltete die Stadt Erwitte eine 1100 Jahr-Feier. Der Oberpräsident der Provinz Westfalen erhob den Ort Erwitte aus Anlass dieses Jubiläums und wegen der großen geschichtlichen Vergangenheit zur Stadt.
Das Wirtschaftsleben in Erwitte war bis zum 19. Jahrhundert überwiegend durch die Ackerwirtschaft bestimmt. Von 1830 bis 1920 blühte hier eine Tabak- und Zigarrenindustrie, die aber nach dem ersten Weltkrieg völlig zum Erliegen kam. In den Jahren 1927 und 1928 entstanden dann in Erwitte 6 Kalk- und Zementwerke, die sich in den folgenden 3 Jahrzehnten zum bestimmenden Wirtschaftsfaktor der Stadt Erwitte entwickelt haben. Als Ende der sechziger Jahre eine wirtschaftliche Rezession bei den Zementwerken eintrat, versuchte die Stadt Erwitte mit Erfolg die vorhandene Monostruktur durch die Ansiedlung mehrerer metallverarbeitender Betriebe zu ändern.
Im Zuge der kommunalen Neuordnung im Jahre 1975 wurde aus 14 Gemeinden des ehemaligen Amtes Erwitte und einer Gemeinde des Amtes Anröchte die neue Stadt Erwitte gebildet. Sitz der Verwaltung ist die Kernstadt Erwitte.
Kirche St. Laurentius
Die St. Laurentius Kirche mit dem mächtigen hochragenden Turm ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen der ganzen Gegend und wurde einst als „die vornehmste Kirche des Herzogtums Westfalens“ bezeichnet. Der älteste Teil der romanischen Kirche, der Wehrturm, hat ein Alter von über 800 Jahren. Bemerkenswert sind die kunstgeschichtlich wertvollen Tympana über 2 Kirchenportalen, ferner im Innern der Kirche die seltene und in Kunstkreisen weithin bekannte „Jakobsleiter“. In den Jahren 1959/60 wurde im Rahmen einer grundlegenden Renovierung die romanische Basilika wiederhergestellt. Das wertvollste Stück der Erwitter Pfarrkirche ist ein sogenanntes Gnadenkreuz, etwa aus dem Jahre 1200. Im November des Jahres 1971 wurde die Kirche von einer schweren Brandkatastrophe heimgesucht, bei der der Kirchturm mit allen Glocken sowie das Kirchendach ein Opfer der Flammen wurden. (Hierüber ist ein Buch „Unser Kirchturm brannte“ von W. Mues erschienen). Beim Neuaufbau wurde der Turmhelm in seiner heutigen sichtbaren Ausführung errichtet. Der Autofahrer auf der B 1 oder der nahen Autobahn wird beim Kirchturm eine stilistische Übereinstimmung mit den Dombauten in Paderborn und Soest feststellen.
Schloss
Die Burg Erwitte war früher das Schloss der Grafen von Landsberg. Es handelt sich um ein Gebäude, welches um 1600 im Stil der Weser-Renaissance errichtet wurde. Nachdem es zunächst als Wohnsitz der Grafen von Landsberg diente, wurde es van dem damaligen Eigentümer im Jahre 1934 an die Deutsche Arbeitsfront verkauft. Nach dem Kriege wurde es 1949 von der Josefsgesellschaft als Kinderheim für körperlich behinderte Kinder erworben und genutzt. So wurde hier die erste Heil-. und Schulungsstätte in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Im Jahre 1959 gab die Josefsgesellschaft ihre Schulungsstätte auf und veräußerte das gesamte Areal an die Bundesrepublik Deutschland zur Errichtung einer Garnison. Nachdem ein Teil des Gebäudes der Graf-Landsberg-Kaserne nicht mehr vom Bund benötigt wurde, hat die Stadt Erwitte im Jahre 1976 das Schlossgebäude erworben und zunächst einmal grundlegend instandgesetzt. Zurzeit wird seitens der Stadt Erwitte eine Nutzungsmöglichkeit gesucht, die dem ortsgeschichtlichen Wert dieses Schlosses Rechnung trägt.
Altes Rathaus
Sehenswert im alten Rathaus, dem ehemaligen Drostenamt, ist der alte Kamin mit dem Wappen der Richter und Beisitzer. Besonderes Interesse verdient hier auch die in Stein gehauene Figur der Hl. Justitia, sowie das zum früheren Pranger gehörige und an der Außentreppe des Rathauses angebrachte „Halseisen“. Ebenso soll der große Stein mit Kette im Kerker des früheren Drostenamtes, an welchen die Verbrecher angeschlossen wurden, nicht unerwähnt bleiben. Uber dem äußeren Türbogen des alten Erwitter Rathauses ist das in Stein gehauene kurkölnische Wappen heute noch bestens erhalten. – Sicherlich war die im Mittelalter gegründete Gerichtsbarkeit dafür ausschlaggebend, dass Erwitte im Jahre 1839 Sitz eines Stadt- und Landgerichts wurde und sogar ein besonderes Gerichtsgebäude erhielt (das leider vor einigen Jahren einem Brand zum Opfer fiel).
Königshof
Der Königshof ist, wie durch die Ergebnisse umfangreicher Grabungen belegt wurde, schon von Kaiser Karl dem Großen als befestigte „curtis“ angelegt worden. Die Curtis stand den Herrschern für militärische Zwecke zur Verfügung; sie hat aber auch dazu gedient, die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Könige und Kaiser bei ihren Reisen durch das Land sicherzustellen. Aus den erhaltenden Originalurkunden ist bekannt, dass Erwitte wiederholt Königsbesuch gehabt hat. Die erste Urkunde wurde am 9. 5. 935 durch Heinrich. II ausgestellt, mit der er Paderborn die freie Bischofswahl und die Immunität bestätigte. Weitere Urkunden wurden in Erwitte durch die Kaiser Otto II. und III, Heinrich II und Konrad II ausgestellt. Während in den ersten Urkunden von einem Königshof in Erwitte nicht die Rede war, gilt die Urkunde des Kaisers Konrad II, ausgestellt am 7. April 1027 in Rom, als erste urkundliche Gewähr für das Bestehen eines solchen Hofes. Durch die vorgenannte Urkunde wurde die „curtis regia Arvita“ zu ewigen Besitz der Paderborner Kirche übergeben. In den darauffolgenden Jahren hat der Königshof eine wechselvolle Geschichte erfahren, da er zwar zum Besitz des Bischofs von Paderborn, jedoch aber unter der Landeshoheit des Erzbischofs von Köln stand.
Die letzten zur eigentlichen Curtis gehörenden Gebäude sind den Wirrnissen des 30-jährigen Krieges zum Opfer gefallen. Das jetzt noch erhaltene Fachwerkhaus stammt aus der Zeit nach dem 30-jihrigen Kriege. Fast 800 Jahre lang, nämlich bis 1803, blieb der Hof im Eigentum des Bistums; erst im Zuge der Säkularisierung ging er in andere Hände über. Die Stadt Erwitte erwarb das Gebäude im Jahre 1938 von dem Oberlandesgerichtsrat Adolf Kreilmann. In dem Königshofgebäude, in dem bis zum Jahre 1968 die damalige Amtsverwaltung untergebracht war, haben heute verschiedene örtliche Vereine ihr Domizil gefunden. Sehenswert sind im Gebäude der König-Heinrich-Saal mit den Wappen der 36 deutschen Orte, in den Heinrich I nachweislich gelebt und beurkundet hat. Der schöne Kamin in diesem Saal ist eine Stiftung des damaligen Kreises Lippstadt. Der große zu halber Erde gelegene gewölbte Keller ist als Kaiserkeller ausgestattet worden. Fotokopien im angrenzenden Kaminraum geben ein Bild von den Urkunden, die deutsche Kaiser und Könige auf der curtis in Arvita mit eigener Hand unterzeichnet haben. Die buntfarbigen Glasfenster des Kaiserkellers zeigen die Gestalt Karls des Großen, des Sachsen-Herzogs Widukind und der Kaiser und Könige Heinrich I, Otto I, II und III, Heinrich II und Konrad II.