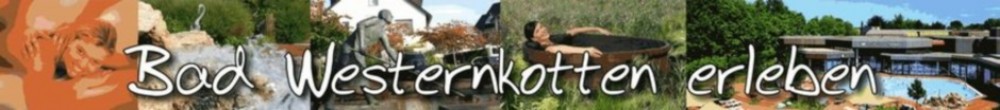Vortrag, den er als Amtsdirektor anlässlich der Sitzung der Amtsvertretung Erwitte am 19. Dezember 1974 hielt. Vergleiche auch die verkürzte Darstellung: Reichmann, Franz, An die Stadt Erwitte übergeben. Abschied von einem Amtsbezirk. Erwitte seit 1856; in: Lippstädter Heimatblätter 55 (1975), S.15-16;22-24;29-30
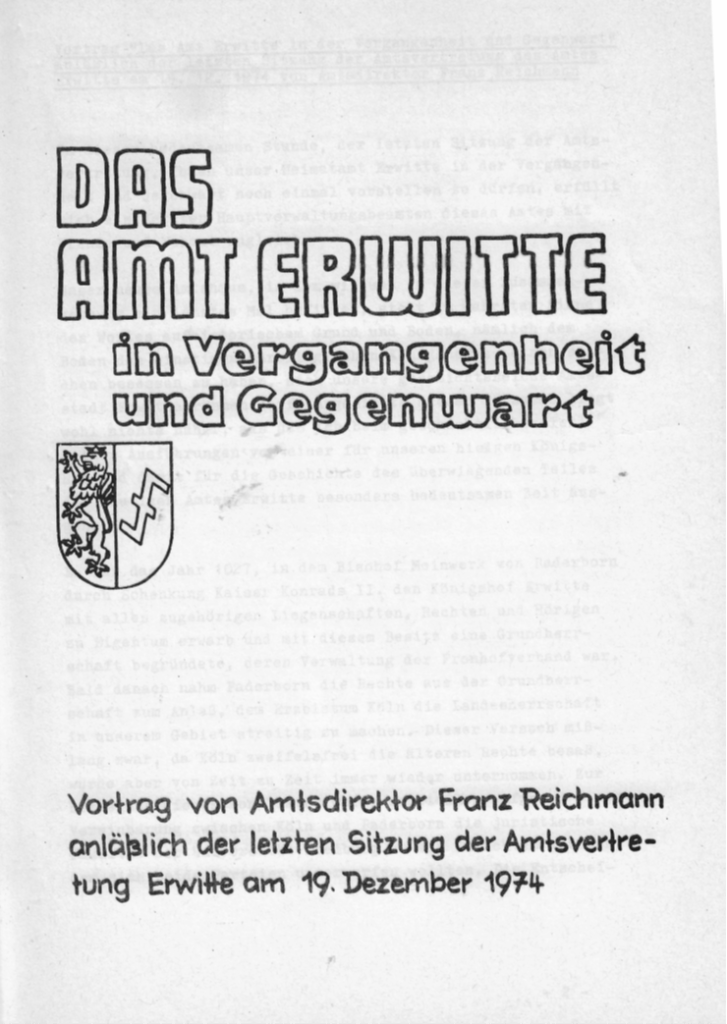
Titelseite des 19-seitigen Abdrucks der Rede [Quelle: Bestand Wolfgang Marcus]
In dieser bedeutsamen Stunde, der letzten Sitzung der Amtsvertretung, Ihnen unser Heimatamt Erwitte in der Vergangenheit und Gegenwart noch einmal vorstellen zu dürfen, erfüllt mich als letzten Hauptverwaltungsbeamten dieses Amtes mit Freude und Wehmut zugleich.
Unser neues Amtshaus, in dem wir uns in dieser Zusammensetzung ein letztes Mal befinden, steht im wahrsten Sinne des Wortes auf historischem Grund und Boden, nämlich dem Boden des einstigen karolingischen Königshofes, einen solchen besessen zu haben, sich unsere geschichtsreiche Amtsstadt Erwitte rühmen darf. Angesichts dieser Tatsache liegt wohl nichts näher, als dass ich beim geschichtlichen Teil meiner Ausführungen von einer für unseren hiesigen Königshof und damit für die Geschichte des überwiegenden Teiles des heutigen Amtes Erwitte besonders bedeutsamen Zeit ausgehe.
Es war das Jahr 1027, in dem Bischof Meinwerk Paderborn durch Schenkung Kaiser Konrads II. den Königshof Erwitte mit allen zugehörigen Liegenschaften, Rechten und Hörigen zu Eigentum erwarb und mit diesem Besitz eine Grundherrschaft begründete, deren Verwaltung der Fronhofverband war. – Bald danach nahm Paderborn Rechte aus der Grundherrschaft zum Anlass, dem Erzbistum K61ln die Landesherrschaft in unserem Gebiet streitig zu machen. Dieser Versuch misslang zwar, da Köln zweifelsfrei die älteren Rechte besaß, wurde aber von Zeit zu Zeit immer wieder unternommen. Zur Beilegung dieses Konfliktes wurde schließlich aufgrund einer Vereinbarung zwischen Köln und Paderborn die juristische Fakultät der Universität Freiburg um ein Gutachten gebeten, dem sich beide Parteien unterwerfen wollten. Die Entscheidung erging am 28. Februar 1583 als sogenanntes ‚Laudum‘, wodurch die Landeshoheit über das Erwitter Gebiet dem Erzbischof von Köln zugesprochen wurde. Gleichzeitig wurden aber auch dem Bischof von Paderborn das Eigentum an seinen Besitzungen in Erwitte, Westernkotten und Umgegend und die aus dem Eigentum herzuleitenden bestätigt.
Die Verwaltung des Fronhofverbandes wurde lange Zelt von den Herren von Störmede ausgeübt. Sie wurden aber im Jahre 1316 dieses Amtes enthoben, weil festgestellt worden war, dass der damalige Verwalter (Meier) des Fronhofes gleichzeitig im Dienst des Erzbischofs von Köln stand, was Paderborn nicht für tunlich hielt. Der Fronhofverband wurde dann aufgelöst und unter Aussonderung des zum eigentlichen Königshof in Erwitte gehörenden Vermögens das Amt (0fficium) Erwitte-Westernkotten gebildet. Der Sitz dieses paderbornischen Amtes war zeitweilig Erwitte, später überwiegend Westernkotten, weshalb es in den überlieferten Aufzeichnungen bald als Amt Erwitte oder Erwitte-Westernkotten. zum anderen als Amt Westernkotten oder Westernkotten-Erwitte benannt wird. Der Verwaltung dieses Amtes waren aber lediglich unterworfen das Vermögen des paderbornischen bischöflichen Stuhles und die Wahrung der mit ihm im Zusammenhang stehenden Rechte. Hierbei handelte es sich vornehmlich um die Einziehung der von den Hörigen an den Bischof zu leistenden Abgaben, die Überwachung der Erbübergänge, für die von den Erben besondere Abgaben zu entrichten waren, u.a.m.
Die 1andesherrliche Verwaltung führte für den Erzbischof und Kurfürsten von Köln der Gograf für das Amt Erwitte, dessen Bezirk wesentlich über das paderbornische Amt hinausging. Ihm oblagen neben der höheren Gerichtsbarkeit auch die Erhebung der Landessteuern und die Wahrnehmung der sonstigen landesherrlichen Rechte, wozu der Glockenschlag, das Geleitsrecht und die Heranziehung zu Hand- und Spanndiensten gehörten. Wegen Zunahme der kriegerischen Verwicklungen brauchten die Landesfürsten mehr Geld. Da der Grundbesitz meist schon verpfändet war, konnten die Einnahmen nur durch eine Erhöhung der Steuern vermehrt werden. An die Stelle der Gografen traten in Kurköln im Jahre 1609 die Drostenämter unter einem Amtmann, denen für die Ausübung der Gerichtsbarkeit ein Richter beigegeben wurde. Der Reichsfreiherr Dietrich von Landsberg in Erwitte erwarb dieses Amt im Jahre 1643 vom Kurfürsten in Köln. Im Jahre 1650 übertrug ihm der Bischof von Paderborn auch die Verwaltung des paderbornischen Amtes Erw1fite-Westernkotten. Durch den vom Bischof in Paderborn bestätigten Rezess im Jahre 1687 wurde der Bitte der amtshörigen Hofstellenbesitzer entsprochen, sieh durch die Zahlung erhöhter Abgaben von dar Leibeigenschaft loskaufen zu können. Die Erblichkeit der Güter wurde anerkannt, ebenso das Recht, sie durch Testament auf Fremde übertragen zu können. Dadurch wurde die Bauernbefreiung, die in den alten preußischen Provinzen erst nach den Befreiungskriegen unter schweren Bedingungen Wirklichkeit wurde, im Bereich der Bistümer Köln und Paderborn, zumindest in unserem Raume, ohne große Härten durchgeführt. Mit der Auflösung des Herzogtums Westfalen fielen das kurkölnische und das paderbornische Amt Erwitte an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt. Die Ämter wurden aufgelöst und kleinere Verwaltungsbezirke, die Schultheißenämter, gebildet. 1816 kam unser Gebiet unter preußische Herrschaft. Paderborn hatte ebenso wie Köln alle seine Rechte verloren. Die Verwaltungsorganisation wurde mehrmals geändert. Aus den vergrößerten Schultheißenbezirken wurden einige Jahre später die sogenannten Bürgermeistereien gebildet. Obwohl Erwitte seit Jahrhunderten Verwaltungszentrum und auch jetzt wieder Mittelpunkt eines Bürgermeisterbezirkes wurde, verblieb der Sitz der Bürgermeisterei in Westernkotten. Auch die 1826 verfügte Verlegung des Verwaltungssitzes von Westernkotten nach Erwitte erfolgte vorläufig nicht. Aufgrund der Westfälischen Landgemeindeordnung von 1856 wurde anstelle der bisherigen Bürgermeisterei wieder das Amt Erwitte gebildet und der seinerzeitige Bürgermeister Anton Schlünder zum Amtmann des neu gebildeten Amtes Erwitte bestellt., Seither besteht diese Verwaltungsform unverändert bis auf den heutigen Tag. Außer der Stadt Erwitte und der Gemeinde Bad Westernkotten gehörten zu dieser Amtsgemeinschaft die Gemeinden Eikeloh, Völlinghausen, Stirpe, Weckinghausen, Overhagen, Herringhausen, Hellinghausen und Benninghausen. Mit Wirkung vom 1. April 1938 kamen durch Umamtung vom Nachbaramt Anröchte die Gemeinden des Kirchspiels Horn, nämlich Berenbrock, Böckum, Ebbinghausen, Horn-Millinghausen, Merklinghausen-Wiggeringhausen, Norddorf, Schallern und Schmerlecke zum Amt Erwitte, so dass der heutige Amtsbezirk 18 Gemeinden mit 16.965 Einwohnern und ein Gebiet von 102,82 qkm umfasst. Sitz der Verwaltung ist seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts unverändert Erwitte.
Zu den geschichtlich besonders bedeutsamen Stätten unseres Amtsbezirks gehören außer der Stadt Erwitte die Gemeinden Bad Westernkotten und Benninghausen, die Gemeinden des alten Kirchspiels Hellinghausen – nämlich Hellinghausen, Herringhausen und Overhagen – sowie die Gemeinde Horn-Millinghausen.
Die Stadt Erwitte gehört als vorfränkische Siedlung zu den frühest bezeugten deutschen Orten. Durch den von Karl dem Großen um 784 in Erwitte errichteten Königshof trat Erwitte in die Geschichte ein. Der mit einer Urpfarrei, der damals einzigen zwischen Soest und Paderborn, ausgestattete Ort wird jedoch urkundlich erst um 836 in den Corveyer Traditionen als Arwitti erwähnt. Nachdem Kaiser Heinrich II. schon 1022 dem Bischof Meinwerk von Paderborn eine Zusage auf den von diesem erstrebten Besitz des Königshofs gemacht hatte, wurde ihm durch Kaiser Konrad II. 1027 die curtis regia zu Erwitte geschenkt. Das durch die Säkularisation 1803 in Privathand und 1938 in das Eigentum der Stadt Erwitte übergegangene von Grund auf restaurierte Hofhaus (Königshof) diente bis 1967 der Verwaltung unseres Amtes und seither bis heute verschiedenen öffentlichen Zwecken unserer Heimatstadt Erwitte.
Im Mittelalter war Erwitte auch Sitz eines kurfürstlichen Gogerichts und eines Freistuhl- und Femegerichts. Zum Erwitter Gogericht gehörten zeitweise mehr als 100 Orte, unter ihnen auch die Stadt Lippstadt. Die Bedeutung der mittelalterlichen Gerichtsbarkeit bewirkte, dass im Jahre 1839 Erwitte Sitz eines Stadt- und Landgerichts wurde, zu welchem Zweck das im Jahre 1973 einem Brand zum Opfer gefallene Gerichtsgebäude am Hellweg, der Bundesstraße 1, erbaut wurde. Dieses Stadt- und Landgericht bestand aber nur bis 1845, dem Jahre der Errichtung von Kreisgerichten. Sitz eines solchen Kreisgerichts wurde damals aber die Stadt Lippstadt. Der nachmalige Amtsgerichtsbezirk Erwitte umfasste 15 Gemeinden der Ämter Erwitte und Anröchte. Bedauerlicherweise wurde unser Amtsgericht schließlich vom Landesgesetzgeber NW mit Wirkung vom 1. Juli 1969 aufgehoben und der Erwitter Gerichtsbezirk dem Amtsgericht Lippstadt zugeordnet.
Erwitte war Jahrhunderte hindurch Sitz berühmter Adelsgeschlechter, so des Geschlechts der Ritter von Erwitte, der Grafen von Landsberg, der Freiherren von Droste, der Freiherren von Hoerde und der Herren von Bredenoll. Aus dieser Zeit sind erhalten das Stammschloss der Grafen von Landsberg, die sogenannte Burg Erwitte, die heute der Bundesrepublik Deutschland gehört, sowie das Schloss der Herren von Droste und Hoerde, das bereits seit 1859 Krankenhaus (von Hoerde’sches Marienhospital) ist.
Das geschichtlich bedeutsamste Bauwerk Erwittes ist jedoch unsere altehrwürdige romanische Pfarrkirche, die – mit Homberg gesprochen – einst „Fürnehmste Kirche des Herzogtums Westfalen“. Die wesentlichen Teile dieses denkmalwerten Bauwerkes stammen aus dem 12. Jahrhundert und der überragend mächtige bis zur Brandkatastrophe am 22. Oktober 1971 ‚schiefe‘ Turm, der selbstbewusst unser Land beherrschte, aus dem 13. Jahrhundert. In den Jahren 1959 bis 1961 wurde die Kirche unter der Leitung des Landeskonservators restauriert und ihr das ursprüngliche Gesicht aus vergangener und doch unvergänglicher Zeit zurückgegeben.
Nicht unerwähnt bleiben darf schließlich noch ein weiteres Kleinod Erwittes, nämlich das in den Jahren 1716/1717 als kurkölnisches Gerichtshaus erbaute Rathaus am Marktplatz, in dem – ebenso wie im Königshofgebäude – bis 1967 ein Teil unserer Amtsverwaltung untergebracht war und heute eine Dienststelle der Kreispolizeibehörde ist.
Mit Urkunde des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen vom ‚Mittsommertage“ 1936 wurde der Gemeinde Erw1tte u.a. mit Rücksicht auf ihre elfhundertjährige ruhmreiche Geschichte und auf ihre Entwicklung zu einem Gemeinwesen mit vorwiegend städtischem Charakter das Recht verliehen, die Bezeichnung Stadt zu führen. Ihre Einwohnerzahl beträgt heute 5.539.
Während die ersten Ansiedlungen der heute 2.757 Einwohner zählenden zweitgrößten Amtsgemeinde Bad Westernkotten bereits auf vorgeschichtliche Zeiten zurückgehen, ist die „Villa Cothen‘ zuerst in einer Urkunde der Herren von Padberg vom 16, Januar 1258 erwähnt, welche die Schenkung eines Morgens Ackerland an die Kirche in Cappel zum Inhalt hat. In späteren Urkunden ist für die Gemeinde auch vereinzelt die Bezeichnung ‚Salzkotten‘ zu finden, weil man früher die Salzhäuser allgemein Cothen oder Kotten nannte. Die Bezeichnung Westerenkoten (heute Westernkotten) hat sich später eingebürgert. Sie ist darauf zurückzuführen, dass der Bischof von Paderborn jeher die Stadt Salzkotten besaß. Um die wahrscheinlich bedeutenderen Salzstätten auf dem hiesigen paderbornischen Besitz von denen Salzkottens unterscheiden zu können, wurde von Paderborn für die Gemeinde gemäß ihrer Lage die Bezeichnung Westernkoten eingeführt. In der Soester Fehde (1444 -1449) wurden von Lippstadt aus, das mit Soest verbündet war, eine Reihe von Ortschaften, u. a. auch die um Westernkotten gelegenen Orte Aspen, Hockelheim, Swiek und Ussen vollkommen zerstört. Demzufolge veranlasste der Bischof von Paderborn die Bewohner der zerstörten Ortschaften, sich ebenfalls in Westerenkoten niederzulassen. Diese Umsiedlung wurde um das Jahr 1500 vorgenommen und im Jahre 1506 die vergrößerte Siedlung durch Wälle befestigt. Durch diese Zusammenlegung und die spätere Einbeziehung von Weringhausen wurde die heutige Ortslage der Gemeinde bestimmt. Die Wallbefestigung konnte nach Einführung der Feuerwaffen jedoch den Ort nicht davor bewahren, dass in den folgenden Jahrhunderten immer wieder Kriegsvölker Westernkotten plünderten und brandschatzen. Auch schwere Seuchen (Pest und Cholera) sind in der Gemeindechronik vermerkt, von denen die im Jahre 1635 aufgetretene Pest am verheerendsten wirkte und die Bevölkerung bis auf 18 vernichtete. Die bis auf den heutigen Tag zur Verehrung der Gottesmutter und des hl. Altarssakramentes von den Westernköttern getreulich gehaltene Lobetagsprozession entspricht einem Gelübde aus jener Zeit.
Mit großer Zähigkeit führten die Westernkötter einen fast 300 Jahre währenden Kampf um die Erhebung ihre Kappellengemeinde zur selbständigen Pfarrgemeinde, die sie schließlich im Jahre 1902 gegen den Widerstand der Erwitter Pfarrherren errangen.
Der im Jahre 1845 erbohrten heilkräftigen Solequelle ist es zu verdanken, dass diese neben der mehr und mehr zurückgehenden Salzgewinnung in zunehmendem Maße Heilzwecken dienstbar gemacht und dass sich so im Verlaufe des vergangenen Jahrhunderts das einstige Sälzerdorf zum Kurort entwickeln konnte. Die heimische Siedesalzerzeugung war der wachsenden Steinsalzgewinnung einfach nicht mehr gewachsen. Daran änderte auch nichts – wie man nachlesen kann – die Arbeitsamkeit der Westernkötter, der es zuzuschreiben ist, dass bereits im Jahre 1832 67.000 Zentner Salz auf der Lippe verladen wurden und im Jahre 1869 allein 40.000 Zentner aus Westernkotten kamen., Ein entscheidendes Verdienst um den Ausbau unseres einstigen Sälzerdorfes zum zeitgemäßen Kurort während der Zeit nach dem 2. Weltkriege hat die auf Betreiben fortschrittlicher Bürger von Westernkotten in Zusammenarbeit mit Vertretern unseres Amtes und des Kreises gemeinsam mit dem Provinzialverband Westfalen, unserem heutigen Landschaftsverband Westfalen-Lippe, und den kommunalen Gebietskörperschaften unseres Kreises mit Ausnahme des Amtes Rüthen und der Gemeinden Cappel und Lipperode im Jahre 1950 gegründete kommunale Badegesellschaft, die Solbad Westernkotten-GmbH., Noch im gleichen Jahre wurden aus dem Besitz des Markgrafen von Meißen die Saline, die Solequelle mit einer Schüttung von 90.000 Liter in der Stunde, 3 Gradierwerke und ein Grundbesitz von 30 Morgen sowie von der ortsansässigen Familie Wiese das Kurhaus und das Badehaus mit Nebengebäuden erworben. Der ständig wachsende Kurbetrieb erforderte in den folgenden Jahren die Erweiterung des Bade- und Kurmittelhauses, die Errichtung einer Kurhalle und eines Konzertsaales, den Bau eines modernen Kurmittelhauses, die Vergrößerung und den weiteren Ausbau des neu angelegten Kurparkes, die Anlegung von Wegen und sonstigen Erholungsanlagen, die Erbohrung einer 2. Solequelle auf einem von der Badegesellschaft zu Eigentum erworbenen Grundstück u. a. m. In Anerkennung dieser gemeinsam mit der Gemeinde geleisteten Aufbauarbeit, durch die Bad Westernkotten mit seinen heilkräftigen Thermalquellen und dem eigenen Moorvorkommen längst in die Familie der deutschen Heilbäder gültig aufgenommen ist, hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen bereits mit Urkunde vom 7. Juli 1958, die der Gemeinde durch den Regierungspräsidenten in Arnsberg anlässlich ihrer 700-Jahrfeier überreicht wurde, das Recht verliehen, den Namen ‚Bad Westernkotten‘ zu führen.
Die Gemeinde Benninghausen, die aus dem eigentlichen Dorf und den Ortsteilen Heide, Kaldewei und Ünninghausen besteht, hat wegen ihrer geografischen Lage als Übergang über die Lippe nach dem Münsterland schon früh eine Bedeutung gehabt. Von einer alten Geschichte kündet der frühromanische, als Wehrturm gestaltete 1000jährige Turm der heutigen Pfarrkirche, die bereits die dritte am Platze ist. Im Jahre 1240 trat für den Ort ein Ereignis von großer Bedeutung ein. Ritter Johann von Erwitte und seine Gemahlin Hildegunde stifteten zum Heil ihrer Seelen das Zisterzienser-Nonnenkloster und schenkten diesem alle ihre Liegenschaften in Benninghausen. Im Laufe der Zeit verlor das Kloster jedoch seinen eigentlichen Charakter und wurde zu einem adligen Damenstift. Es ging sogar die Verbindung mit dem Zisterzienserorden verloren, so dass schließlich der Kölner Erzbischof bis zur Aufhebung des Klosters im Jahre 1804 die Oberleitung übernahm. Die Zisterzienser-Nonnen haben die alte Kirche, die sie 1240 vorfanden, abgerissen und eine neue gebaut die den Dorfbewohnern, dem großen Dienstpersonal und den Chor- und Laienschwestern Platz bot. Diese Kirche wurde im Laufe der nächsten 300 Jahre baufällig und 1514 durch die Äbtissin Anna von Ketteler unter Beihilfe der Dorfgemeinde durch eine neue, die heutige Pfarrkirche, ersetzt. Dieses Bauwerk findet das hohe Lob der Kunstsachverständigen wegen seiner außerordentlich schönen Raumwirkung. Es wurde in den Jahren 1957/1958 unter Leitung des Landeskonservators restauriert, Im Jahre 1527 hat die damalige Äbtissin von Oheimb das Klostergebäude abreißen lassen und ein neues errichtet, welches wir heute noch in seiner imposanten Größe vor uns haben. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss vom Jahre 1803 beginnt für das Kloster der zweite Abschnitt seiner Geschichte. Es wurde aufgehoben und zunächst der Krone Hessen-Darmstadt, 1816 aber Preußen zugeteilt. Im Jahre 1820 wurde das Kloster durch den Oberpräsidenten von Vincke als Landarmenhaus für Westfalen eingerichtet. Sehr bald darauf wurde hier auch ein Arbeitshaus gegründet. 1891 wurde das Landarmenhaus aufgelöst und nach Geseke verlegt, wo es heute als Fachkrankenhaus für Geriatrie weitergeführt wird. Nach einer recht wechselhaften Geschichte und Zweckbestimmung während des vergangenen Jahrhunderts wurde schließlich im Jahre 1960 auch die Auflösung des Landesarbeitshauses eingeleitet und inzwischen verwirklicht. Das heutige Westfälische Landeskrankenhaus Benninghausen dient überwiegend Geistes- und Alterskranken. In seinen Mauern befand sich auch jahrelang ein Landeserziehungsheim, das jedoch im Jahre 1966 nach Dorsten verlegt wurde.
Mit Recht können aber auch die Gemeinden des alten Kirchspiels Hellinghausen auf ihre denkmalwerten Bauten als Zeugen hervorragenden Schaffens ihrer Vorfahren stolz sein. Das Kleinod des Dorfes Hellinghausen ist die im Jahre 1780 erbaute einfache Dorfkirche mit ihrem romanischen Westturm, die in den Jahren 1957 – 1961 unter Mitwirkung des Landeskonservators instandgesetzt wurde. Zur Gemeinde Herringhausen gehört das im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts entstandene Wasserschloss des Freiherrn von Schorlemer, das wegen seiner großzügigen, symmetrischen Gesamtplanung gerühmt wird. Schließlich verdient noch das vom Freiherrn von Schorlemer 1619 erbaute Schloss Overhagen erwähnt zu werden, in dessen Bereich seit 1962 ein als Ersatzschule genehmigtes Gymnasium betrieben wird.
Zu den ältesten Siedlungen unserer engeren Heimat gehört auch die Kirchspielgemeinde Horn, die sich seit dem Jahre 1954 unter Einbeziehung des Namens ihres zweiten Ortsteiles Millinghausen Horn- Millinghausen nennt. Sie ist dem Dunkel ihrer Vergangenheit ebenfalls durch die Corveyer Traditionen entrissen. In diesen wird nämlich im Jahre 823 ein Haufus in Haron erwähnt der dem Kloster Corvey 2 Unterhöfe mit Kotten und Wäldern schenkte. Es darf als sicher angenommen werden, dass das Stift Meschede, dem der Haupthof Horn unterstellt war, und dessen Gründung zwischen den Jahren 850 und 875 liegt, bereits eine gelegentliche Seelsorge im alten Haron betrieben hat.
Die Pfarrei Horn ist eine alte Mutter-Pfarrei, obwohl sie erst in dem kölnischen Abgabenbuch ‚Liber valoris‘ urkundlich um 1313 vorkommt. Schon die zugehörigen alten Ortschaften Berenbrock, Böckum, Ebbinghausen, Merklinghausen-Wiggeringhausen, Norddorf, schallern, Schmerlecke (dieses ist durch einen Schenkungsakt Kaiser Ludwigs des Frommen als Ismereleke bereits 833 erwähnt) und Seringhausen im Amtsbezirk Anröchte sowie die höhere Besteuerung im ‚Liber valoris‘ deuten auf ein hohes Alter hin.
Bei der Beleuchtung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Amt Erwitte zeigt uns ein nüchterner Blick in das Zeitgeschehen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, dass unsere Vorfahren länger und härter arbeiten und wesentlich karger leben mussten als wir. Auch in unserer engeren Heimat war es nicht besser als anderswo. Außer der Saline in Bad Westernkotten und zwei Zigarrenfabriken in Erwitte gab es im Amt Erwitte gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts keine Industrie. Handel und Gewerbe waren nur geringfügig vertreten und darauf abgestellt, den örtlichen Bedarf der Dorfbewohner zu befriedigen. Die 1854 in Betrieb genommene Eisenbahn Paderborn-Hamm berührte zwar in Benninghausen und Horn den Amtsbezirk Erwitte, doch waren die örtliche Lage der Bahnhöfe weit ab von diesen Gemeinden und der mangelhafte Zustand der Verbindungswege nicht dazu angetan, die Niederlassung eines Industrieunternehmens daselbst zu begünstigen. Die ackerbautreibende Bevölkerung war daher im Amtsbezirk Erwitte in einer bedeutenden Überzahl. Die bäuerlichen Familien mit dem männlichen und weiblichen Hilfspersonal zählten im Jahre 1861 2.625 Vollbeschäftigte bei einer Gesamtbeschäftigtenzahl von 3.250. Von den 625 sonstigen Beschäftigten war der größte Teil auch noch nebenbei landwirtschaftlich tätig.
Dank dem Bau der Warstein-Lippstädter Eisenbahn, der heutigen Westfälischen Landeseisenbahn, die am 1. November 1883 das erste Mal den „Feurigen Elias“ die Haar hinauffahren ließ, erhielt auch Erwitte und Bad Westernkotten mit Umgebung Anschluss an das Verkehrsnetz des Deutschen Reiches. Das rheinisch-westfälische Industriegebiet und auch die industriell erstarkte Kreisstadt Lippstadt gaben der Landbevölkerung bessere Verdienstmöglichkeiten und nahmen in den folgenden Jahrzehnten bis zum 1. Weltkrieg den überwiegenden Teil des Bevölkerungsüberschusses der Amtsgemeinden auf. Handelsbeziehungen zum Industriegebiet wurden nach und nach angeknüpft und verschiedene Selbsthilfeeinrichtungen der Landwirtschaft ins Leben gerufen, so die Molkereigenossenschaften in Erwitte und Benninghausen 1891, in Horn 1892, die 1964 mit Erwitte fusionierte, die Filiale der Westfälischen Kornverkaufsgenossenschaft Soest in Erwitte 1891, im Jahre 1951 die Landwirtschaftliche Trocknungsgenossenschaft in Erwitte und schließlich 1954 die Gemüsebau- und Absatzgenossenschaft Bettinghausen-Horn, die jedoch bereits 1968 mit der gleichnamigen Genossenschaft in Soest zusammengelegt wurde.
Hand in Hand mit dieser Entwicklung entstanden die heimischen Geldinstitute, und zwar bereits im Jahre 1865 die Sparkasse der Ämter Erwitte und Anröchte mit dem Sitz in Erwitte und in der Folgezeit die Spar- und Darlehnskassen in Bad Westernkotten, Benninghausen und Horn-Millinghausen sowie eine Zweigstelle der Volksbank Lippstadt in Erwitte.
Den Versuchen der Gemeinden und fortschrittlich gesinnter Bürger, im Amte Erwitte auch eine industrielle Entwicklung in Gang zu bringen, blieb bis zum 1. Weltkrieg der Erfolg versagt. In Erwitte stieg zwar die Zahl der Zigarrenfabriken auf 4 und die Zahl der beschäftigten Tabakarbeiter auf rd. 300, dagegen verlor die Salzgewinnung in Bad Westernkotten immer mehr an Bedeutung. Überörtliche Bedeutung erlangten nur die Brennereien Siedhoff in Schmerlecke und Beckmann in Böckum, die beide 1867 gegründet wurden.
Der unglückliche Ausgang des 1. Weltkrieges bewirkte, dass die Erwitter Tabak- und Zigarrenfabriken sämtlich ihre Pforten schließen mussten. Hinzu kam, dass das rheinisch-westfälische Industriegebiet durch die Veränderung der Wirtschaftslage nicht mehr imstande war, den Bevölkerungsüberschuss aus unserem Gebiet aufzunehmen. In dieser Notzeit wurde jedoch der Grundstein zur Entwicklung einer gesunden örtlichen Industrie gelegt. 1924 wurde in Benninghausen ein Sauerstoffwerk gegründet, dem 1953 ein Propangas-Großvertrieb folgte. In Erwitte wurde 1919 das erste Kalkwerk errichtet, das leider bereits 1921 in Konkurs ging, vom Zementsyndikat angekauft und stillgelegt wurde. Leider war auch den in dieser Zeit gegründeten Chemischen Werken in Erwitte keine lange Lebensdauer beschieden.
Amtsbürgermeister a.D. Maurer, seit 1954 Ehrenbürger der Stadt Erwitte, der 1920 mit der Verwaltung des Amtes Erwitte betraut worden war, erkannte bald, dass der herrschenden Arbeitslosigkeit durch Leistung von Notstandsarbeiten allein nicht abzuhelfen war. Deshalb sah er es als wichtigste Aufgabe an, eine bodenständige Industrie nach Erwitte zu ziehen. Das gute und ausgedehnte Kalksteinvorkommen in der Gemarkung Erwitte für die Errichtung von Kalk- und Zementwerken zu nutzen und die Ansiedlung leistungsfähiger Betriebe zu fordern, erachtete er daher als einzigen Ausweg aus der wirtschaftlichen Not jener Tage. So entstanden in den Jahren 1926 bis 1930, 1950 und 1964 die heutigen 7 Werke. Diese stellten zunächst Kalk- und Naturzement her und hatten einen schweren Stand, ihre jungen Betriebe gegen den Widerstand des Zementsyndikats zu behaupten. In dem mehrjährigen Ringen um ihren Bestand wurden die Werke von der Stadt Erwitte tatkräftig und erfolgreich unterstützt. Nachdem der Antrag des Zementsyndikats auf Zwangskontingentierung der dem Verband nicht angeschlossenen Zementwerke von der Reichsregierung abgelehnt worden war, konnten sie ihren Ausbau vollenden und standen beim Ausbruch des 2. Weltkrieges im Jahre 1939 in einer günstigen Aufwärtsentwicklung. Während des Krieges wurden die Werke stillgelegt bzw. ihre Produktion stark eingeschränkt. Nach Beseitigung der Kriegsschäden konnten sie im Jahre 1946 die Produktion, die sie bereits vor dem Kriege auf Portlandzement umgestellt hatten, wieder aufnehmen und im Zuge der fortschreitenden Wirtschaftskonjunktur erheblich ausweiten, so dass die heutige Gesamtproduktionskapazität 11.000 Tagestonnen liegt.
Den nachhaltigen Bemühungen von Rat und Verwaltung der Stadt Erwitte, die mit der Zementindustrie immer noch vorherrschende wirtschaftliche Monostruktur abzubauen, war durch die Niederlassung einiger beachtlicher Ausgleichsbetriebe wie einer Armaturen-Fabrik, eines Asphaltmischwerkes, einer Fabrik zur Herstellung von Betonfertigbauelementen eines großbetrieblichen Zentralversandlagers mit insgesamt rund 800 Arbeitsplätzen in der jüngsten Vergangenheit auf dem Wege zur Fertigstellung ihrer kommunalwirtschaftlichen Struktur ein verheißungsvoller Erfolg beschieden.
Eine besonders erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung in den zwei Jahrzehnten nach dem Kriege hat wie bereits erwähnt auch die Gemeinde Bad Westernkotten dank ihrer heilkräftigen Naturschätze und ihrer Bewerten Zusammenarbeit mit der kommunalen Bade-Gesellschaft genommen. So ist Bad Westernkotten heute überwiegend auf den Kurbetrieb ausgerichtet, was die Tatsache verdeutlicht, dass die Hälfte aller ortsansässigen Unternehmen dem Heilbad dienstbar ist, die fast 80% der gemeindlichen Gewerbesteuer erbringen, und somit das Heilbad die hoffnungsvolle Lebensader der heutigen Gemeinde ist.
Anders liegen die Dinge bei den meisten nach wie vor landwirtschaftlich strukturierten Gemeinden des Kirchspiels Horn, von denen nur Horn-Mielinghausen, Böckum und Schmerlecke dank des ortsansässigen Gewerbes eine verbesserte eigene Steuerkraft haben, so dass der eigentliche Nervus rerum des ganzen Kirchspiels der Landesfinanzausgleich im Wege von Schlüsselzuweisungen ist.
Besondere Erwähnung verdienen im Rahmen dieses Vortrags auch die in den Amtsgemeinden während der zweieinhalb Jahrzehnte nach dem Kriege mit Hilfe von Kreis, Land und Bund sowie auch des Amtes durchgeführten Maßnahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet des Bildungswesens, des Sports und der Freizeitgestaltung, des Gesundheitswesens, der Wasserversorgung der Ortsentwässerung und nicht zuletzt des Straßen- und Wegebaues.
Hier sollen nur die Bedeutendsten kurz erwähnt sein. – In 8 Gemeinden wurden 10 Schulen neu gebaut bzw. umfangreich erweitert. 5 neue Kindergarten sind in 3 Gemeinden entstanden, ein weiterer befindet sich zurzeit im Bau. Zur Förderung des Schul- und Vereinssports wurden in 8 Gemeinden neue Sportanlagen geschaffen. Die grundlegende Erneuerung und Erweiterung des Marienhospitals in Erwitte sind mit namhaften Zuschüssen gefördert worden. 2/3 der Amtsgemeinden erhielten erstmalig eine zentrale Wasserversorgung. In 8 Gemeinden wurde eine zentrale Ortsentwässerung geschaffen und in 4 Gemeinden erfolgte der Bau von vollbiologischen Kläranlagen. In allen Gemeinden hat ein umfassender Ausbau der Ortsstraßen stattgefunden. Darüber hinaus wurden nicht weniger als 224 km land- und forstwirtschaftliche Wirtschaftswege ausgebaut.
Wie es schließlich um die arbeitsmarktpolitische Situation in den einzelnen Erwerbszweigen unseres Amtsbezirks steht, lässt das Ergebnis der letzten Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung von 1970 wie folgt erkennen:
- Landwirtschaft: 479 Betriebe, 702 Arbeitsplätze
- Industrie: 23 Betriebe, 1.174 Arbeitsplätze
- sonstige gewerbliche Arbeitsstätten: 305 Betriebe, 668 Arbeitsplätze
- Dienstleistungen: 182 Betriebe, 1.200 Arbeitsplätze
Insgesamt: 991 Betriebe, 3.744 Arbeitsplätze
Diesem Arbeitsplatzangebot stehen nach der vorerwähnten Zählung 6.033 ortsansässige Arbeitskräfte gegenüber, sodass 2.289 Erwerbspersonen als Arbeitskraftreserve für eine künftige Strukturverbesserung zur Verfügung stehen.
Wenn nun das Amt Erwitte mit seinen Gemeinden, ausgenommen die 4 ‚Lippe-Gemeinden‘ (Benninghausen, Hellinghausen, Herringhausen und Overhagen), nach über 100-jähriger nutzbringender Existenz einschließlich der Nachbargemeinde Seringhausen mit Wirkung vom 1. Januar 1975 in einer neuen Stadt Erwitte mit einer Fläche von 89,02 qkm hat diese neue kommunale Gebietskörperschaft die Aufgabe, die notwendigen Einrichtungen der allgemeinen Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Hierbei werden ihr dies bereits erwähnten ökonomischen Faktoren zugutekommen, aber auch die sehr günstige Anbindung an den überregionalen Verkehr, das vorhandene Arbeitskräftereservoir und nicht zuletzt das gute Niveau der örtlichen Infrastruktur im Bereich des Bildungswesens, des Sports, der Freizeitgestaltung und der Krankenfürsorge.
An der Spitze einer Vielzahl der sich stellenden Aufgaben steht unzweifelhaft die Beseitigung der wirtschaftlichen Monostruktur durch Bauleitplanung und Grundstückserschließung für die Niederlassung geeigneter gewerblich-industrieller Ausgleichsbetriebe in Erwitte und der weitere zeitgerechte Ausbau des Heilbades Westernkotten. Es bedarf gewiss keiner näheren Begründung, dass die allgemeine Daseinsvorsorge nur aktiviert werden kann, wenn die neue Stadt hierbei die wirkungsvolle Hilfe der übergeordneten staatlichen und kommunalen Gebietskörperschaften erfährt. Hierzu ist die Aufnahme der Stadt Erwitte, die im Landesentwicklungsplan I als zentraler Ort für einen Versorgungsbereich von 10.000 bis 20.000 Einwohnern ausgewiesen ist, in den Landesentwicklungsplan II als Entwicklungsschwerpunkt 3. Ordnung eine wichtige Voraussetzung, die sich der neue Erwitter Wirtschafts- und Lebensraum am Schnittpunkt zweier bedeutsamer Entwicklungsachsen in jeder Beziehung verdient.