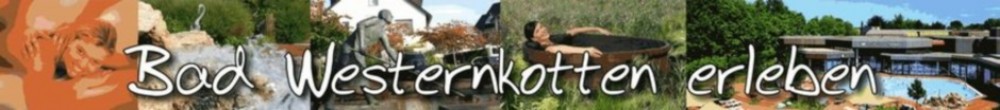Von Wolfgang Marcus
[am 29.07.1998 hatte ich für ein geplantes Salzbuch über Bad Westernkotten einen 39 Seiten umfassenden Aufsatz mit dem o.g. Titel erstellt. Leider kam es dann nicht zu dem Salzbuch. Jetzt fand ich den Aufsatz in meinen Beständen wieder. Ich habe ihn in den letzten Tag ein wenig aktualisiert, in Bezug auf die Rechtschreibung alle Dokumente an die heutige Schreibweise behutsam angepasst, mit einem Literatur- und Quellenverzeichnis versehen und eine Kartenskizze ergänzt. Einzelne Abschnitte dieser umfangreichen Darstellung wurden später in Teilabschnitten und verkürzt veröffentlicht. WM, 16.11.2025]
1. Die Westernkötter Saline unter dem neuen Landesherren Preußen
Nach der Niederlage Napoleons und der politischen Neuordnung im Gefolge des Wiener Kongresses gelangte das Herzogtum Westfalen, und damit auch Westernkotten, an Preußen: Am 15. Juli 1816 überließ es der Großherzog von Hessen-Darmstadt dem preußischen König.
Das Kurfürstentum Brandenburg hatte bereits 1582 ein staatliches Salzmonopol eingeführt, das, vom Staat als kräftig sprudelnde Einnahmequelle geschätzt, 1652 durch Preußen erneuert wurde und fortan in Kraft blieb [vgl. Westheider 1994, S.196]. Wenn neue Länder dem preußischen Staatsgebiet einverleibt wurden, schnitt die Regierung umgehend den jeweiligen Salzwerks-Interessenten alle Möglichkeiten eines freien Salzhandels im Inland ab, ohne jedoch den vorhandenen Auslandshandel zu beschränken. Mit den Sälzern wurde über eine feste Abnahmemenge und einen Festpreis verhandelt, und dann durften diese nur noch an staatliche Verkaufsstellen, sogenannte Faktoreien oder Sellereien, verkaufen. Und wenn die Sälzer nicht mitspielten, dann hatte der Staat viele Mittel in der Hand, eine Lösung zu erzwingen, so etwa durch die Drohung, selber Salz zu produzieren oder Salz aus anderen Salinen oder Bergwerken zu beziehen und im Umfeld der Saline zu verkaufen. So erging es zum Beispiel der Saline Salzkotten, die trotz anfänglich heftiger Proteste letztlich doch klein beigeben musste. [vgl. dazu Piasecki 1991, S. 161/162]
In Westernkotten übte Preußen aber nicht nur als Landesherr staatlichen Einfluß aus, sondern besaß auch die Eigentumsrechte an 1/15 Anteil, dem sog. landesherrlichen Salinenanteil. Nachdem die Großherzöglich-bergische Generalbergwerks-Administration am 1. Oktober 1811 dem Postmeister Bredenoll aus Erwitte für 6 Jahre diesen Anteil verpachtet hatte und die Pacht danach nochmals um 1 Jahr verlängert wurde, einigte man sich Ende 1818/Anfang 1819 auf Wunsch des Postmeisters darauf, das Pachtverhältnis zu beenden. Die Schlüsselübergabe erfolgte am 19.1.1819 [Akte 30 „Personalsachen“ des Depositums].
Als Verwalter dieser staatlichen Saline fungierte seitdem ein königlicher Salzfaktor. Zum einen war er damit für das landesherrliche Gradierwerk und die dazugehörige Salzhütte zuständig, wobei seine vorgesetzte Behörde das königliche Oberbergamt in Bonn war. Zum anderen kontrollierte er aber auch noch als Teil der staatlichen Steuerverwaltung die Salzproduktion auf der ganzen Saline. So mußte er unter anderem darüber wachen, daß im Rahmen der Verträge das in Westernkotten produzierte Salz an die staatlichen Faktoreien ausgeliefert bzw. auf der sog. Niederlage in der Saline selbst verkauft wurde. Darüber hinaus mußte er aber auch dafür Sorge tragen, daß kein Salz veruntreut, gestohlen und so auf dem freien Markt verkauft wurde. Die vorgesetzte Dienststelle in dieser Beziehung war das Hauptsteueramt in Paderborn.
Die Königliche Salzfaktorei befand sich nach Aufzeichnungen aus dem Jahre 1825 in dem heutigen Haus Aspenstraße 8 [Marcus, Wolfgang, Salzfaktoren in Westernkotten; in: Aus Kuotten düt un dat Nr.46, 1992, dort auch nähere Quellenangaben]. Für das Jahr 1829 ist für dieses Haus der Eintrag „Brockhoff, Provinzial-Steuer-Direktorat“ zu finden.
Der erste königliche Salzfaktor Brockhoff trat seine Stellung in Westernkotten Anfang 1819 an. Er bekam am 23.März 1819 eine umfassende Dienstanweisung vom Oberbergamt aus Bonn [Akte 30 des Depositums], aus der deutlich wird, daß das Oberbergamt nun frischen Wind in die landesherrliche Anlage bringen wollte, die seinerzeit sogar stillstand. Zunächst sollte ein Arbeiter einer anderen königlichen Saline, entweder aus Königsborn (bei Unna) oder Neusalzwerk (Bad Oyenhausen), gefunden werden, um „beim Betrieb der Siedung in neuer Kote mit Steinkohlen zu arbeiten, und die hierin ungeübten Westernkottener Arbeiter zugleich zu unterweisen.“ Da nicht sicher war, ob ein Sieder von dort zu finden war, sollte auf der bisherige Sieder Friedrich Krillecke einen Lehrgang in Königsborn absolvieren. Weiterhin schreibt das Oberbergamt:“Ein Salzkorb ist, wie das königlichen Salzamt in Königsborn anzeigt, nach Westernkotten verabfolgt worden, dessen Kosten wir bereits erstattet haben, der also dort als Muster aufbewahrt werden kann.“ Zusätzlich wird Salzfaktor Brockhoff angehalten, für die alsbald dort eintreffenden Kohlenfuhren ein mit Eisen beschlagenes, geeichtes Scheffel anzuschaffen.
Im Juli/ August 1819 nahm dann der Sieder Rittelmeyer aus Neusalzwerk seinen Dienst auf. Da die Steinkohlenzufuhr noch unsicher erschien, wollte man sich mit Postmeister Bredenoll über den Ankauf seines Holzvorrates einigen. Als Preis sollte „1 Thaler für jedes Fuder ad 40 Börden und außerdem noch 5 Stüber Biergeld für jedes 3. Fuder“ gezahlt werden.
Brockhoff blieb bis 1839 königlicher Salzfaktor in Westernkotten. Durch Dienststellentausch nahm am 11.November 1839 Wilhelm Weierstraß seinen Dienst als königlicher Salzfaktor und Salinenadministrator auf. Vorher war er als Rendant des Königlichen Hauptsteueramtes in Paderborn tätig gewesen. Weierstraß blieb [nach Ausweis von Akte 30 des Depositums] bis Juni 1859 in Westernkotten tätig.
- Gesetzliche und gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Der Abschluss eines „Verkaufs- und Lieferungs-Contracts“ und das „Reglement wegen Einführung des Salzregals in …Westfalen(?)“
Folgende Vertragsinhalte sind (bisher) bekannt:
1818 durften die Westernkötter nur insgesamt 6000 Tonnen Salz produzieren und an die Debits-Verwaltung verkaufen. [Akte 30, erstes Aktenstück]
1821/22: 6500 Tonnen (à 7 Reichstaler 10 Sgr)
1836-1850: bis 9000 Tonnen (6500 Tonnen à 4 Thaler, 2500 noch für 2 Reichstaler 12 Sgr)
Um 1855: 8000 – 9000 Tonnen.
2.2.Weitere Rahmenbedingungen
- Ein Regierungserlass der zum 1.7.1816 in Kraft trat, verbot für Westfalen und die Rheinprovinzen den Import und auch den Handel von fremden Salzen. Das Salz durfte nur noch aus den sog. Niederlagen auf den Salinen und aus den Faktoreien bezogen werden. Die Mindestabnahmemenge betrug 1 Tonne. Auf den Einzelhandelspreis nahm der Staat keinen Einfluß [Amtsblatt der königl. Regierung in Arnsberg 1816, S. 61-64; vgl. auch Stockmann, S.139] Der Verkaufspreis wurde zentral mit 12 Thaler pro Tonne festgelegt. Aufgehoben wurden allerdings alle Zwangsvorschriften zur Abnahme einer bestimmten Menge Salz (Salzkonskription) – 1826 allerdings wieder eingeführt.
- Eine weitere wichtige Rahmenbedingung ist der Salzbedarf in dieser Zeit. Er belief sich für die preußischen Rheinprovinzen und Westfalen um 1820 auf ca. 13000 Lasten. 15 Jahre später war er bereits um mehr als 2000 Lasten gestiegen, und er nahm immer noch weiter rapide zu. „Gerade in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erfuhr die Kochsalznachfrage durch die aufblühende Glas-, Papier- und besonders durch die Baumwoll- und Sodaindustrie eine starke Steigerung. Auch die Landwirtschaft verbrauchte in verstärktem Maße bei der Viehzucht und beim Ackerbau Salz. Preußen war daher bestrebt, die inländische Salzproduktion zu heben, weshalb es sein Augenmerk auch auf Steinsalzbohrungen richtete, die für viele Salinen später zum Ruin werden sollten.“ [Stockmann S. 139/140]
- Die Konkurrenz der Gradiersalinen wurde auch dadurch größer, daß durch nunmehr mögliche Tiefbohrungen (1816 erstmals erfolgreich eingesetzt) die Förderung hochkonzentrierter Sole ermöglicht wurde, die nicht mehr aufwendig gradiert werden mußte. „Um 1850 setzte die Hälfte der über 70 Salinen konzentrierte Solen ein.“ [Stockmann S. 163] Dennoch mussten bereits zwischen 1830 und 1870 17 Salinen ihre Produktion einstellen.
- Wegen der angespannten Verhältnisse auf dem Salzmarkt trat die Westernkötter Saline vor 1848 dem „Verein Westfälischer Privatsalinisten“ bei, der von dem Werler Sälzeroberst Christoph Freiherr von Lilien ins Leben gerufen worden war und dem bis 1848 noch die Salinen Werl, Soest [?], Sassendorf und Gottesgabe (Rheine) angehörten. Unter anderem wollte man den Salzabsatz gemeinsam regeln und sich gegen die Konkurrenz der Staatsalinen Neusalzwerk (Bad Oyenhausen) und Unna-Königsborn wehren. Der Verein schloß sich dem in Frankfurt gegründeten „Verein zum Schutz der vaterländischen Arbeit“ an, der sich für die Einführung von Schutzzöllen stark machte. Auf der Nationalversammlung 1848 in Frankfurt am Main wurde er durch den Salinendeputierten Freiherr von Dolffs vertreten. [Stockmann, S. 163/164].
3. Salzpreise
Den Großhandelspreis für eine Tonne Salz à 400 Pfund (=1/5 einer heutigen Tonne) setzte Preußen 1816 für Westfalen und das Rheinland mit 12 Thaler fest, zwischen Elbe und Weser lag der Preis bei 8 Thaler 12 Groschen pro Tonne. [Amtsblatt Arnsberg 1816, S.61-64]. 1820 vereinheitlichte Preußen die Preise. Der Großhandelspreis für eine Tonne Salz aus allen Salinen und staatlichen Faktoreien betrug nun 15 Thaler. [Jarren 1988, S.270; der Pfundpreis im sog. Detail-Salzhandel schwankte in Preußen bis 1842 je nach Entfernung zu den Faktoreien zwischen 13 und 15 Pfennigen].
Betrachtet wir nun demgegenüber den Preis, den die Produzenten vom Staat als Aufkäufer erhielten: 1821/22 erhielten die Sälzer 7 Reichstaler und 10 Silbergroschen pro Tonne [vgl. Akte 13 des Depositums]. Nach Angaben des von Landsberg’schen Rentmeisters Ignatz Köhler zahlte die Preußische Regierung von 1836 bis 1850 an die Produzenten in Westernkotten pro Last vierzig Reichstaler für das „gewöhnliche Quantum“ von 650 Lasten = 6500 Tonnen (alt). Das macht pro damalige Tonne 4 Reichstaler, also eine gewaltige Differenz gegenüber dem Verkaufspreis.
Dennoch: Auf die heutige Tonne berechnet erzielten die Salzinteressenten in Westernkotten um 1840 einen Preis von 20 Reichsthalern. Das erbrachte in der Summe Einnahmen für alle Salzinteressierten von etwa 26 000 Reichstaler.
Dazu zahlte das Provinzial-Steuer-Direktorat für insgesamt nochmals 250 Last „Mehrquantum“ je Last 24 Reichstaler, also 12 Reichstaler bezogen auf die heutige Tonne. Das sind bei 250 Lasten insgesamt 6 000 Reichstaler. Insgesamt konnten die Salinen-Interessierten also mit festen Verkaufserlösen von 32 000 Reichsthalern rechnen, wenn sie in der Lage waren, die Gesamtmenge des zugestandenen Salzes auch tatsächlich zu liefern. Diese Einnahmen teilten sich dann nach den jeweiligen Anteilen am Salzwerk. [zu den Produktionskosten vgl. unter 5.]
4. Salzmengenproduktion
Häufig finden sich in der Literatur fehlerhafte Mengenangaben, da die zu verschiedenen Zeiten unterschiedlichen Gewichtsangaben nicht beachtet wurden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die in Westernkotten ab 1816 verwendeten Gewichtsangaben:
- 1 Scheffel = ¼ Tonne
- 1 Metze = 1/16 eines Scheffels
- 1 Last = 10 Tonnen alt = 4 000 Pfund preußisch = 40 Zentner
- 1 Tonne(alt) = 400 Pfund = 4 Zentner = 1/5 Tonne neu (heutige Tonne)
- 1 Zentner = 110 Pfund
- [Amtsblatt Arnsberg 1816, S. 85ff, Köhler, Beschreibung, S. 45/46]
Wichtig ist zunächst einmal, noch mal daran zu erinnern und zu konstatieren, daß die Salzmengen durch die Abnahmeverträge mit der Salzdebits-Verwaltung [vgl. 2.1.] reglementiert waren.
Für den behandelten Zeitraum konnten folgende Produkionszahlen und der entsprechende Geldwert ermittelt werden [nach Akte 13 des Sälzerdepositums usw.]
| Jahr | Salzprodukion | Geldwert d.Produktion |
| 1816 | ||
| 1817 | ||
| 1818 | ||
| 1819 | ||
| 1820 | ||
| 1821 | 6500 Tonnen | 47667 Thaler |
| 1822 | 6500 | 47667 |
| 1823 | ||
| 1824 | ||
| 1825 | ||
| 1826 | ||
| 1827 | ||
| 1828 | ||
| 1829 | ||
| 1830 | 6894 Tonnen | 48014 |
| 1831 | ||
| 1832 | 6668 | 45314 |
| 1833 | 6910 | 46645 |
| 1834 | 7227 | 48858 |
| 1835 | 7438 | 43865 |
| 1836 | 7504 | 30455 |
| 1837 | 9931 | 31768 |
| 1838 | 9614 | 30833 |
| 1839 | 9383 | 31498 |
| 1840 | 9703 | 32516 |
| 1841 | 9801 | 33366 |
| 1842 | 9016 | 30711 |
| 1843 | 8604 | 29724 |
| 1844 | 8834 | 30009 |
| 1845 | 9529 | 32489 |
| 1846 | 10037 | 34732 |
| 1847 | 8652 | 29486 |
| 1848 | 9325 | 31734 |
| 1849 | 9323 | 31716 |
| 1850 | 8990 | 26543 |
| 1851 | 9165 Tonnen (à 400 Pfd.) | 30254 |
| 1852 | 12560 | 36370 |
| 1853 | 9660 | 28097 |
| 1854 | 10170 | 30668 |
| 1855 | 8680 | 26098 |
| 1856 | 8850 | 26620 |
| 1857 | 9990 | 30158 |
| 1858 | 9123 | 27680 |
| 1859 | ||
| 1860 | ||
| 1861 | 9870 | 31519 |
| 1862 | ||
| 1863 | ||
| 1864 | ||
| 1865 | ||
| 1866 | ||
| 1867 | ||
| 1868 | ||
| 1869 |
Vergleichen wir noch kurz diese Zahlen mit dem sonstigen „Bergbau“ im Kreis Lippstadt. In der „Statistischen Darstellung des Kreises Lippstadt 1863 [Lippstadt 1863, hrsg. vom Landrat von Schorlemer] heißt es: „Der Bergbau im Kreis ist von Unerheblichkeit. Die Gewinnung von Raseneisenerz bei Lippstadt ist in den letzten Jahren wieder aufgegeben. – In Westernkotten ist eine Saline, wobei verschiedene Private betheiligt sind.“ [S.56] Aus der anschließenden Tabelle wird dann deutlich, daß die Saline Westernkotten innerhalb des bergbaulichen Bereiches eine besondere Rolle gespielt hat: Während die Saline 1861 ein Quantum an weißem Kochsalz in Höhe von 39 519 Centnern im Wert von 31 519 Thalern produzierte, kamen die verschiedenen Erzgruben nur auf einen Wert von 184 Thalern!
5. Produktionskosten
Hier kann keine umfassende, für jedes Jahr detaillierte Antwort auf die Frage nach der Höhe der „Selbstkosten des Salzes“ gegeben werden. Beispielhaft soll eine Aufstellung des Salzfaktors und Salinenadministrators Weierstraß aus dem Jahre 1850 vorgestellt werden [vgl. Akte 13 im Depositum Pfännerschaft Saline Westernkotten].
Am 5.2.1850 bekommt Weierstraß nämlich den Auftrag und die Aufforderung vom Oberbergamt aus Bonn, sich „gutachtlich über die Höhe der Selbstkosten des Salzes auf dem pfännerschaftlichen Salinenantheil der Saline Westernkotten während der letzten 5 Jahre zu äußern“ und dabei speziell „zu berücksichtigen, auf wie hoch die Zinsen der auf Melioration der Salinenbetriebs-Vorrichtungen verwendeten Kapitalien sich belaufen und welchen Einfluß der, seit 1848 beträchtlich verminderte Kohlenpreis auf die Selbstkosten des Salzes künftig äußern wird.“
Weierstraß antwortet mit Datum vom 26.3.1850. Nach einführenden Erläuterungen, wie er zu den Zahlen gekommen ist und daß sie „der Wahrheit ziemlich nahekommen“, folgt die folgende Aufstellung:
„Annähernde Ermittlung der Produktionskosten einer Tonne Salz bei der Privat-Saline Westernkotten von 1845 – 1849
Die Privat-Interessentschaft hat jährlich 8545 Tonnen à 405 Pfund für die Debits-Verwaltung und ca. 75 Tonnen Pachtsalz, Summa 8620 Tonnen zu gradieren.
Es betragen die Produktionskosten, insoweit sie bekannt, oder
zu schätzen sind:
- An Besoldungen für 4 Verwaltende 400, 200, 80, 60 Thlr = 720 Thlr
- Die Löhne für
- den gewerkschaftlichen Salzwieger jährlich 186 Thl 20 Sgr
- 6 Hüttenknechte, 3 Gradierer à 10 Thl monatl. 1080Thl
- 4 dito à 15 Thaler monatlich 720Thl
- 1 dito und 1 Gradierer à 8 Thl monatlich 192Thl
- für Hülfsarbeiter überhaupt 60Thl
- Unterhaltung v. 7 Gradierpferden m. Knechtslohn 1050Thl
- für 1200 Scheffel Steinkohle zur Speisung der
von Landsberg’schen Dampfmaschine 320Thl =3608Thl 20
- Für Materialien
- Steinkohle zu 8620 Tonnen Salz à 3 ¾ Scheffel pro Tonne
und zum Preis von durchschnittlich 8 Sgr = 8620Thl
- für Brennholz, Stroh, Mauerziegel, Pumpenleder, Hanf,
Pfannenblech. Oel zur Erleuchtung und Schmierfett betrugen die
Ausgaben für die landesherrliche Siedeanstalt nach dem Durchschnitt
der letzten 10 Jahre 26Thl 5 Sgr, macht für die 8 Privat-Siede-
anstalten, in Berücksichtigung, daß darunter 3 größere Pfannen, wofür
das Doppelte berechnet wird =287 Thlr 25
- Für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen und Geräthe
Die hierfür einschlägigen Kosten haben für den landesherrlichen
Antheil nach dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre betragen nahe
40 Thl und werden hiernach für die Privat-Interessenschaft betragen = 550 Thlr
- Meliorations-Bauten
Außer den Unterhaltungsbaulichkeiten sind bei dem gewerkschaft-
lichen Betriebsgebäuden Haupt-Reparaturen nicht und keine weiteren
Meliorationen, als die Salzbohrversuche und die Röhrenfahrt nebst
Zubehör, zur Benutzung der Soole aus dem Bohrloch No.1 vorgekom-
men. Die daselbigen Ausgaben haben für die Privat-Interessentschaft
bis circa 1849 betragen 10340 Thl
Die Zinsen dafür betragen à 5 Prozent = 517 Thlr 9
- Abgaben und Gefälle
- Grundsteuer, veranschlagt zu = 15 Thlr
- Gewerbesteuer, bekanntlich 214 % = 168 Thl
- Säure-Societäts-Beiträge etwa = 100 Thl
- Von ca. 26 Tonnen Pachtsalz an Private jährlich = 210 Thlr
- Geldrente =306 Thlr 10 Sg
Die gesamten Kosten der Produktion betragen also = 15169Thl4Sg
8545 Tonnen, die verkauft wurden, machen pro Tonne 1 Thl 23 Sgr 3 Pf.“
Abschließend fügt er hinzu, dass der Rückgang der Steinkohlenpreise auf 6 Sgr pro Scheffel einen Rückgang der Produktionskosten pro Tonne auf 1 Thl 15 Sgr 10 Pf. bewirken wird. Die Produktionskosten für den landesherrlichen Anteil gibt Weierstraß für 1849 mit 1 Thl 16 Sgr 1Pf an.
Wenn man berücksichtigt, daß der Staat in dieser Zeit für 6500 Tonnen „gewöhnliches Quantum“ 4 Reichstaler pro Tonne zahlte, lag für dieses Quantum der Gewinn für die Pfännerschaft bei mehr als 2 Reichsthalern pro Tonne. Für weitere 2500 Tonnen „Mehrquantum“ zahlte der Staat 2,4 Reichstaler (2 Reichstaler und 12 Sgr); hier lag die Gewinnspanne also etwa bei 1 Reichstaler.
Noch weitere Zahlen: Zieht man die von Weierstraß ermittelten jährlichen Produktionskosten von 15169 Reichsthalern und 4 Silbergroschen von dem von ihm für 1849 ermittelten Geldwert der Produktion der 14 Privatanteile von 30170 Reichsthalern ab, so verbleibt ein Jahresgewinn von fast genau 15000 Reichsthalern für alle Privatinteressenten. Für 1 Anteil ergibt das immerhin die schöne Summe von circa 1007 Reichsthalern, immerhin etwa das 8fache, was ein Gradierer pro Jahr verdiente.
Für die Jahre 1853 bis 1855 errechnet Weierstraß [in einem Schreiben an den Landrat in Soest vom 13.12.1855, Akte 13 Sälzerdepositum] dann allerdings nur noch einen Reinertrag pro Pfannenanteil von etwas mehr als 832 Reichstaler pro Pfannenanteil; vor allem begründet er das mit niedrigeren Preisen, die von der Salzdebits-Verwaltung seit dem neuen Salzlieferungsvertrag ab 1853 pro Tonne gezahlt werden.
6. Die räumlichen Auswirkungen der Saline in der Ortsmitte von Westernkotten
Die Saline Westernkotten hat nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Bezug auf das Ortsbild das Dorf Westernkotten im 19. Jahrhundert stark geprägt.
Einen ersten Eindruck verschafft die Skizze des Paderborner Zeichenlehrers F.J. Brand [vgl. Heimatbuch von 1987, S. 173]
Die Zeichnung zeigt Westernkotten etwa um das Jahr 1840 von Erwitte aus. Im Vordergrund wahrscheinlich die heutige Friedhofslinde. Mindestens drei Gradierwerke lassen sich ausmachen, die schon durch ihre Höhe das Ortsbild dominieren: ganz links wahrscheinlich das sog. Große Gradierhaus entlang der Weringhauser Straße, dann weiter rechts ein Gradierhaus, das gegenüber dem heutigen Kurhaus stand, sodann noch rechts des Kirchturms die Bredenollsche Saline.
Detaillierte Angaben vermittelt das 1829 angelegte preußische Urkataster. Die nachfolgende Abbildung stellt eine Reinzeichnung dar:
Im Einzelnen bedeuten die Signaturen [nicht eindeutig auf der Karte zuzuordnen] folgendes:
A = Kappler Brunnen
B = Mittelbrunnen
C = Windmühlenbrunnen
I = Das sog. Großes Gradierhaus, von Landsberg gehörend
II = Die sog. Neue Gradierung, von Landsberg gehörend
III = Das sog. Kleine Gradierhaus, von Landsberg gehörend
IV = Ein weiteres Gradierhaus südlich von III, ebenfalls von Landsberg
V = Jessesches Gradierwerk
VI =
VII =
VIII= Großes von Papen’sches Gradierhaus
IX = Kleines von Papen’sches Gradierhaus
X = Löpersches Gradierhaus
XI = Bredenollsches Gradierhaus
1, 2 und 3 = von Landsbergische Siedehütten
4 = Brexelsche Hütte (von Landsberg angepachtet)
5 = von Papensche Hütte
6 = Jessesche Hütte
7 = Bredenollsche Hütte
8 = Löpersche Hütte
9 = Königliche Hütte
Holzplätze
Kohleplätze und Kohlehütten, dazwischen „Röhrenfahrt“.

Die Gebäudestatistik 1861 zählt für Westernkotten 328 private und 5 öffentliche Gebäude (Kirche, 2 Schulen, je ein Gebäude der Staats- und der Ortsverwaltung). Die 328 Privatgebäude teilen sich wie folgt auf (in Klammern die Vergleichszahlen von Lippstadt):
223 (653) Wohnhäuser
28 (18) Fabrikgebäude, Mühlen und Magazine
77 (380) Ställe, Scheunen, Schuppen.
Mit 28 Salinen, Gradierhütten usw. hat Westernkotten zusammen mit Geseke die höchste Zahl von „Fabrikgebäuden“ im ganzen Kreisgebiet.
7. Die Gradierwerke und Hütten im Einzelnen
Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, alle Dornengradierwerke, die in Bad Westernkotten gestanden haben und wovon zwei heute noch stehen, sowie alle Salzhütten und Brunnen vorzustellen.
Wichtigste Grundlage dafür ist das 1829 angelegte Urkataster sowie die „Beschreibung der Saline Westernkotten“, die Rentmeister Köhler etwa 1840 anfertigte.
- Die Gradierwerke
Wahrscheinlich wurden erstmals kurz nach 1700 Dornenzweige des Schwarzdorns (lat. Prunus spinosa), den meisten als Schlehe bekannt, in einem Gradierwerk verwendet, und zwar in Sulza in Thüringen, in der Nähe von Weimar [Walter, Manuskript eines Vortrages in Salzkotten 1997, S. 10] Über die weitere Ausweitung dieser Technik besonders in unserem Raum gibt die nachfolgende Tabelle Auskunft:
Beispiele zur Einführung der Dorngradierung
Saline Jahr
Sulza bei Weimar nach 1700
Nauheim 1716
Allendorf 1720
Unna 1738
Salzkotten nach 1740
Westernkotten 1765-1780
[nach Walter 1989, S. 11 u.a.; die Berechnung für Westernkotten erfolgte nach Seetzen; vgl. dazu den Beitrag in diesem Buch]
I. Das älteste Gradierwerk, die sog. Kleine Gradierung (ca. 1765-1858)
Dieses in Nord-Süd-Richtung erbaute Gradierwerk, das von Landsberg gehörte, stand an der Weringhauser Straße gegenüber dem früheren Badehaus. Es war eine einfache Flächengradierung mit 2 Wänden, die ein Breite von 12 Metern (einschließlich dem dazugehörenden Sole-Reservoir), eine Höhe von 12,50 Meter und eine Länge von 25,10 Meter hatte. „Dieses älteste Gradierwerk ist 1858 abgebrochen.“[HB 1958, S.181] Es wurde [nach Berechnungen im Anschluß an Seetzen] zwischen 1765 und 1780 erbaut.
Östlich dieses Gradierwerkes stand das Sole-Reservoir für die von Landsberg’schen Siedehäuser. Es war ursprünglich einstöckig. Nach 1858 wurde ein zweites Stockwerk mit dem noch brauchbaren Holz aus dem Abbruch des genannten Gradierwerkes daraufgebaut. Die Abbildung zeigt eine Konstruktionszeichnung des von Landsberg’schen Verwalters Bruns aus dem Jahre 1832 (?).[Bestand Landsberg-Velen, Karten 133 und 136, A 9109]
Nördlich dieses Gradierwerkes befanden sich 2 sog. Roßkünste, also Pferdegöpel, von denen eins zur Belegung der Gradierung mit Sole, das andere zur Hebung der gesättigten Sole in den Siedesolkasten diente.
Neben diesem Gradierhause stand 1840 noch eine sog. Sonnengradierung, auch Flächen- oder Pritschengradierung genannt, auf der die Sole auf schräggestellten Bretterwänden, die mit Schrägleisten versehen waren, herunterfloß. Diese schräggestellten Bretterwände sahen von der Seite wie ein Zelt aus, das ganze Werk war 31,40 Meter lang und 7,50 Meter breit, nach Osten 0,62 Meter und nach Westen 1,90 Meter hoch. [Heimatbuch 1958, S.181]
- Das kleinste Gradierwerk (ca. 1780 – nach 1930)
Es stand nördlich des unter I. genannten, also gegenüber dem heutigen Kurhauseingang, auch in Nord-Süd-Richtung, gehörte ebenfalls von Landsberg und war 4,50 Meter breit, 20 Meter lang und 12 Meter hoch. Das Foto entstammt einer alten Ansichtskarte:
- Das Große von Landsberg’sche Gradierhaus (ca. 1780 – 1954)
Es stand an der heutigen Weringhauser Straße (Kurpromenade) etwa dort, wo sich heute das Park-Café befindet. Es hatte ursprünglich eine Höhe von 12,56 Meter und eine Länge von 94,20 Meter und war eine Vierflächengradierung. Es soll seinerzeit das höchste Gradierwerk in Westfalen gewesen sein.
Am 9. November 1800 ist dieses Leckhaus bei einem großen Sturm eingestürzt. Mit dem Wiederaufbau ist bald begonnen worden, so daß 1803 die Gradierung wieder aufgenommen werden konnte. Dieses Leckhaus, in Ost-West-Richtung erbaut, hatte nach Angaben von Köhler eine Höhe von 40 Fuß, eine Breite von 20 Fuß und eine Länge von 300 Fuß und bestand aus einer einfachen Flächengradierung mit zwei Wänden.
An der nördlichen Seite hatte es ein Pferdegöpel, das mit Einführung einer Dampfmaschine 1836 [vgl. dazu den Beitrag von Maron] nur noch beim Ausfall der Maschine zum Einsatz kam. Die Dampfmaschine stand in einem westlich an das Gradierhaus angebauten Gebäude von 26 Fuß Länge, 24 Fuß Breite und 10 Fuß Höhe. Fotos im Besitz der Heimatfreunde Bad Westernkotten zeigen den Maschinenraum und die Dampfmaschine.
- Das von Papen’sche Gradierwerk (… – nach 1930)
Es lag entlang der heutigen Leckhausstraße und hatte nach Ausweis des Urkatasters eine bedeutsame Länge. Westlich davon lag eine Roßpumpe, also ein Pferdegöpel zur Hebung der Sole auf das Gradierwerk.
- Das Jessesche Gradierwerk
Es lag an der heutigen Salzstraße etwa im Bereich des heutigen Kurhausparkplatzes und hatte eine West-Ost-Erstreckung. Nördlich der Westspitze lag die Roßkunst, wiederum einige Meter nördlich direkt an er heutigen Salzstraße das Jesse’sche Salzhaus.
Die Soleförderung auf das Gradierwerk wurde bereits vor dem ersten Weltkrieg eingestellt. [Heimatbuch 1987, S. 80]
- Das Bredenollsche Gradierwerk (etwa 1800- ca. 1918)
Aus dem Urkataster von 1829 ist die Lage des Bredenollschen Gradierhauses gut zu ermitteln. Es lag nördlich der Schützenstraße im Winkel mit der Bredenollgasse, also auch in der unmittelbaren Nähe des Bredenollschen Wohnhauses, und verlief in West-Ost-Richtung. Es hatte eine Länge von….
Nördlich des Gradierwerkes lag das Bredenollsche Siedehaus., zwischen beiden das Göpelwerk.
Der Betrieb der Bredenollschen Saline wurde vor dem 1. Weltkrieg eingestellt. Im Herbst 1917 [das Heimatbuch 1987, S.480, nennt 1916] stürzte das Bredenollsche Gradierwerk „nach einem starken Novembersturm sonntags vor der Frühmesse“ [ebd.] teilweise ein [R. Steimann; Zur Geschichte der Familie Bredenoll-Steimann-Hille, a.a.O. S.31]. Die Giebelfront, die zur Bredenollgasse zeigte, stürzte auf das Dach des gegenüberliegenden Hauses der Eheleute Franz Schulte und Elisabeth geb. Wucherpfennig. Die Tochter Sofia, später verheiratet mit Franz Lüning, hatte zu diesem Zeitpunkt gerade ihr Zimmer in der oberen Etage verlassen und kam so mit dem Schrecken davon. Aus diesem Grund errichteten die Eheleute Schulte nach dem Erwerb des Salinengrundstückes ein Wegkreuz, das allerdings nicht mehr steht.
- Das Löper’sche Gradierwerk (… – ca. 1921)
erst im Dorf gelegen
später Neubau Ecke Nordstraße/Antoniusstraße
Der Betrieb auf der Löper’schen Saline wurde schon vor dem 1. Weltkrieg eingestellt.
vgl. Beitrag von Löper
- Das große Gradierwerk im heutigen Kurpark (1835-heute)
Dieses Gradierwerk, eine einwändige kubische Gradierung, ließ der Graf von Landsberg 1835 etwas mehr als 50 Meter nördlich seines großen Gradierhauses (sieh III.) errichten (HB 1958, S. 181). Es hatte zunächst nur eine Länge von etwa 43 Metern, eine Breite einschließlich des darunter liegenden Sole-Reservoirs von 40 Fuß (= 12 Meter) und eine Höhe von 12,25 Meter. Es wurde auch von der 1836 errichteten Dampfmaschine beschickt.
Die Konstruktionszeichnungen für den Bau fertigte der damalige Salinenverwalter Bruns [Dep. Landsberg-Velen, Kartensammlung, A 9116]:
1857/58, also einige Jahre nach der Erbohrung der Solequelle „Westernkötter Warte“ im heutigen Kurpark, erweiterte man das Gradierwerk um mehr als 50 Meter nach Norden und 1858/59 nochmals nach Süden.
Das Gradierwerk ist mehrmals erneuert worden, letztmalig nach einem Teileinsturz vom 26.6.1983, und dient heute der Freiluftinhalation. Mit Wirkung vom 18.12.1984 ist es in die Denkmalliste der Stadt Erwitte aufgenommen.
- Das kleine Gradierwerk im heutigen Kurpark (1934-heute)
Noch 1934 ließ der Graf von Landsberg auf der sog. Isernen Schute ein neues Gradierwerk bauen. Der Unterbau wurde aus neuem Buchenholz errichtet, der obere Teil fast ganz aus dem alten von Papen’schen Gradierhaus an der Leckhausstraße entnommen. [Heimatbuch 1958, S. 182]. Es verläuft von Nordwest nach Südost und ist 58 Meter lang und 13 Meter hoch. Eine Gesamtrestaurierung des Werks fand in den Jahren 1995/96 für 1,35 Mio. DM statt. Die Dornenwand besteht aus 24 Feldern mit einer Breite von je 2,15 Metern, daneben befindet sich ein Treppenturm mit einer Breite von 2 Metern.
7.2. Die Salzhütten
Die folgende Übersicht listet die Salzhütten für die Jahre 1775, 1840 und 1893 auf:
| 1775 [nach Köhler] | 1840 [nach Köhler] | 1893 [nach Stellmacher] |
| 10 Hütten mit insges. 15 Pfannen | 9 Hütten mit 9 Pfannen | 7 Hütten mit 7 Pfannen |
| von Landsberg | ||
| Brexels H. (1Pfanne) | Brexels | Hütten Nr. |
| Bredenolls (2) Korffs (1) Bücks (1) | Bredenolls Craes Bücks | 1 3 7 |
| von Schade Craes-Hütte (2) Benninghauser (2) Bredenoll Becks Hütte (2) Hense/Jesse Captains Hütte (1) Löper Doktors Hütte (2) Kloster Liesborn Liesborner Hütte (1) | von Papen von Papen’sche H. Bredenollsche H. Jesse’sche Hütte Löpers Hütte Königreich Preußen Fiskalische Hütte (Nr.4) | Von Papen (Nr.5) Bredenoll (Nr. 8) Jesse (Nr. 2) Löper (Nr. 6) |
Zwischen 1775 und 1840 fiel die Korff’sche Hütte weg und die Craes-Hütte kam an von Landsberg; die Liesborner Hütte gelangte an den Fiskus; in fast allen Hütten wurde die Kohlenfeuerung eingeführt und in jeder Hütte auf eine einzige, größere Pfanne umgestellt. Die Grundfläche aller Pfannen betrug im Jahre 1834 606 Quadratmeter [HB 1958, S.184]
Zwischen 1840 und 1893 fiel eine von Landsberg’sche Hütte weg; 1868 dann noch die fiskalische.
Noch 1938 nahm Graf von Landsberg eine neue Hütte an der Lippstädter Straße (B 55) in Betrieb.
Über die einzelnen Hütten konnte folgendes in Erfahrung gebracht werden [nach Angaben des Urkatasters usw.] Abbildungen u.a. Konstruktionszeichnungen aus dem Dep. Von Landsberg]
Hütte Nr.1 (von Landberg)
Hütte Nr. 2 (Jesse)
Hütte Nr. 3 (von Landsberg)
Hütte Nr. 4 (Fiskus)
Hütte Nr. 5 (von Papen)
Hütte Nr. 6 (Löper)
Hütte Nr. 7 (von Landberg)
Hütte Nr. 8 (Bredenoll)
Die neue von Landsberg’sche Hütte
Dieses Siedehaus hatte zwei Pfannen, eine große und eine kleinere. Die große Pfanne lieferte täglich 6 bis 7 Tonnen Salz, die kleinere anderthalb Tonnen. Am 1. Dezember 1943 ging die Landsberg’sche Saline durch Kauf an den Prinzen Christian Friedrich von Sachsen, Markgraf von Meissen, über. Dieser hat das Siedehaus am 9.9.1949 an die Firma Huth, Westfälische Bekleidungsindustrie GmbH, verkauft. Derzeit befindet sich in dem Gebäude ein Autohandel.
8. Die am Salzwerk beteiligten Interessenten und Arbeiter
8.1. Die Interessenten
Nach einem Protokoll vom 29. Juli 1834 [zitiert nach: Der Patriot: Westfälische Wirtschaft vor 100 Jahren…] bestanden folgende 15 Pfannenanteile:
von Landsberg 8 Anteile
von Papen 2 ½ „
Bredenoll 1 ½ „
Jesse 1 „
Loeper 5/6 „
Erben Vernholz 1/6 „
Der Fiskus (Landesherr) 1 „
15 Anteile
Diese Anteile sind auch für 1821/22 anzunehmen, wo die gleichen Anteilseigner (allerdings ohne Nennung der Höhe der Anteile) genannt sind [Akte 13 des Sälzerdepositums].
Um 1840 stellten sich die Anteile nach Aussage des von Landsberg’schen Rentmeisters Köhler [vgl. entsprechenden Beitrag] wie folgt dar:
von Landsberg 7 5/6 Anteile
von Papen 3 „
Gebr. Bredenoll 1 1/3 „
Erben Jesse 1 „
Erbsälzer Löper 5/6 „
Der Fiskus (Landesherr) 1 „
15 Anteile
In den dazwischenliegenden 6 Jahren müssen also die Erben Vernholz ihren Anteil von 1/6 ganz verkauft haben, mit ziemlicher Sicherheit an von Papen. Von Landsberg und Bredenoll haben ebenfalls 1/6 Anteil weniger, so daß anzunehmen ist, daß diese aus Zweckmäßigkeitsgründen – etwa, um nicht mehr verschiedene Anteilseigner an ein und derselben Pfanne zu haben – ebenfalls an von Papen verkauft haben.
Bis auf den landesherrlichen Anteil, der etwa 1868 wegfiel, was die Gesamtzahl der Anteile auf 14 verringerte, bestanden diese Anteile auch noch im Jahre 1893 [vgl. Stellmacher a.a.O.]
8.2. Die Verwaltung der Saline
Die Interessentschaft der Saline, das heißt alle Eigentümer der einzelnen Salinenanteile bzw. deren Verwalter, versammelte sich nur hin und wieder im Jahr, um Grundsätzliches zu besprechen. Sie wählte aus ihrer Mitte eine kleine Gruppe, die sog. Salinen-Deputation, die quasi als Aufsichtsrat und Geschäftsführung fungierte. Die Arbeit vor Ort wurde von einem Salinen-Kontrolleur überwacht und geleitet.
Aus der nachfolgenden Dienstanweisung für den Salinen-Kontrolleur aus dem Jahre 1856 [Akte 35 des Sälzerdepositums] gehen die einzelnen Aufgaben recht gut hervor. Gleichzeitig gibt das Dokument einen wichtigen Einblick in die damaligen Arbeitsbedingungen und die Organisation der Saline:
„Instruction für den gewerkschaftlichen Salinenaufseher und Salzwieger (vom 28.5.1856)
Eingang und Allgemeines
§ 1 Da die Dienstverrichtungen des Salinen-Aufsehers als die ausgedehnteren und indem sie gewissenhaft vollzogen werden, im gewerkschaftlichen Interesse als die wichtigeren erscheinen, so soll die amtliche Stellung dieses gesellschaftlichen Asfizianten (?) künftig die Bezeichnung Salinen-Controleur führen.
§ 2 Mit derselben ist ein Diensteinkommen von zwei hundert vierzig Thalern jährlich verbunden, welches in Monats- oder Quartal-Raten, je nach besonderer Übereinkunft von jedem der Herrn Interessenten, respective deren Mandanten hier am Orte, pro Rate ihres Salinenantheils gezahlt wird, wogegen alle bisher vom dem gewerkschaftlichen Salzwieger bezogenen Einkommen künftig wegfallen.
§ 3 Die Stelle wird auf Kündigung verliehen, in der Art, daß sechs Monate nach Bekanntmachung eines die Entlassung anordnenden Conventions-Beschlusses der Interessentschaft das Dienstverhältnis aufhört.
§ 4 Der Salinen-Controleur ist der Salinen-Deputation, als Organ der Interessentschaft, dienstlich untergeben und daher verpflichtet, den Anordnungen der fungierenden Salinen-Deputierten gehorsam und willig Folge zu leisten und alle dessen dienstlichen Aufträge und Weisungen pünktlich auszurichten und nachzukommen. Dieselbe Verpflichtung besteht in Betreff der auf sein Geschäft sich beziehenden Anordnungen und Aufträge der einzelnen Herrn Interessenten, wenn und insoweit ihm deren Erfüllung von den Salinen-Deputierten anbefohlen wird.
§ 5 Ohne Erlaubniß der letzteren, und bevor für die Stellvertretung Vorsorge getroffen, darf der Salinen-Controleur sich nicht vom Orte entfernen, und ist im Allgemeinen zur Dienstleistung auf der Saline zu jeder durch Umstände gebotenen Zeit, insbesondere aber verpflichtet, in den Sommermonaten
von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends
und in den Wintermonaten von October bis incl. Februar
von 8 Uhr früh bis 5 Uhr abends
auf der Saline anwesend sein, ausgenommen von 12 Uhr bis 1 Uhr Mittags.
Zu seinem Aufenthalt in den Zwischenzeiten der Abfertigung pp. soll für ihn eine Stube im Maschinenhause zur Ausrichtung seiner schriftlichen Arbeiten, und zur Aufbewahrung seiner Register und Schriftstücke unter Verschluß auf Kosten der Interessentschaft eingerichtet werden. Das nothwendige Mobiliar dieses Stübchens hat sich der Salinen-Controleur selbst zu beschaffen. Im Dienst muß derselbe stets passend gekleidet und an der Kopfbedeckung mit dem Bergwerks-Emblem erscheinen.
§ 6 Die Dienstleistungen des Salinen-Controleurs theilen sich in
- Die Controlierung der Salzproduction und des Salz-Absatzes, sowie des Absatzes an Vieh-Salz, der Abgabe an Pacht- und Deputat-Salz und an Salzabfällen aller Art.
- Ueberwachung des Verkehrs auf der Saline und in den Siedehäusern zum Zwecke der Verhinderung und Entdeckung von Salz-, Soole- und Materialien-Diebstählen und Veruntreuungen.
- Ueberwachung der Salinen-Arbeiter in Bezug auf die Erfüllung der denselben durch ihre Instruction vorgeschriebenen Verpflichtungen und
- spezielle und sorgfältige Ueberwachung der gemeinschaftlichen Soole-Quellen, Brunnenhäuser, Soole-Leitungen und Inventarstücke.
Abtheilung 1: Die Kontierung der Produktion und des Absatzes auf der Saline (§§ 7-17)
§ 7 Über die Salz-Produktion und die Viehsalz-Ausgabe ist von dem Salinen-Controleur ein Jahres-Register nach Muster A zu führen, worin jede Siede-Anstalt ihr Conto hat. Diese Contos werden monatlich am 20.summirt und abgeschlossen, beim Jahresschlusse aber am 31. December. Aus diesem Conto ist jeden Monat am 21.und beim Jahresabschlusse am 2. Januar der Salinen-Deputation ein Auszug nach Formular B und ein Duplikat davon gleichzeitig der königlichen Salzfaktorei einzureichen. Bei Eintragung des Zuganges in die Konten ist mit geeigneter Sorgfalt dahin zu sehen, daß obgleich das Salz nicht in die Magazine hinein gewogen werden kann, dennoch keine erheblichen Differenzen zwischen den wirklichen und den Soll-Beständen bei völliger Entleerung der Magazine sich ergeben. Solche Differenzen werden, wenn sie vorkommen, durch Ab- und Zuschreiben zwar ausgeglichen, erfordern aber, wenn sie erheblich sind, der Interessenschaft gegenüber der gründlichsten Rechtfertigung.
§ 8 Über die Ausgabe an Koch- und Viehsalz durch Verkauf und Versendung seitens der Debits-Verwaltung sind für jedes Jahr 2 besondere Register, nach dem auf Grund des § 11 des letzten Salzlieferungs-Contracts von der Salz-Debits-Verwaltung vorgeschriebenen Formulare, ferner über die Bereitung und den Absatz an Viehsalz außerdem ein Jahresregister nach Formular C zu führen, vid.§ 10c.
In das erste Register wird der Verkauf an Koch- und Viehsalz chronologisch nach der Nummer-Folge der von der königlichen Faktorei erteilten Wiegescheine, deren Nummern für jedes Quartal vom 1.bis zum letzten Tage fortlaufen, einzutragen. Dasselbe ist nicht nur bei jedem Wechsel der Range von einem zum anderen Magazin zu summieren, sondern auch monatlich mit Reinzitulation (?) der Beträge für jedes Magazin, am 20.und am Jahresschluß dem 31. December abzuschließen. Das Register über das versandte Salz an die Faktoreien und in die Rhein-Provinz ist gleichmäßig nach der Nummernfolge der Wiegescheine, welche die Faktorei darüber erteilt, zu führen und in derselben Weise, wie das Verkaufs-Register zu summieren und zu denselben Zeiten abzuschließen respective zu reinzituliren.
Aus dem Verkaufs- und Speditions-Register ist allemal am Monats- respective Jahres-Abschlüsse der Salinen-Deputation ein Auszug nach Muster D mit den gesammelten und nach den respektiven Magazinen geordneten Wiegezetteln zu überreichen, und ein Duplikat davon der königlichen Faktorei vorzulegen. Gleichzeitig ist die im § 11 des letzten Salz-Verkaufs-Kontraktes vorgeschriebene und zur Weitersendung an den Ober-Steuer-Kontrolleur bestimmte Leistungs-Nachweisung für den abgelaufenen Monat beizufügen.
Die Wiegescheine der Faktorei über das verkaufte und zu versendende Salz werden von dem Salinen-Controleur gesammelt, und dürfen künftig nicht mehr den Hüttenknechten zur Abgabe an ihre Herrschaft, wie früher angeordnet war, abgegeben werden, indem die betreffenden Herrn Interessenten solche am Schlusse eines jeden Monats von der Salinen-Deputation erhalten werden.
§ 9 Pachtsalz darf ebenfalls nur auf Ausgabeschein der Faktorei abgegeben werden. Auf diesen sowohl als auf den schriftlich bei der Faktorei beruhenden Anweisungen der Interessenschaft, ist in dem Falle, wo die Abgabe in dem herkömmlichen Gefäß (Mollen) geschieht, auch das Gewicht derselben im Ganzen zu attestieren.
§ 10 In Bezug auf den Viehsalz-Absatz, welcher hier sowohl in kleinen Quantitäten von 32, 64, 96 Pfund pp. und in Tonnen à 400 Pfund stattfindet, hat der Salinen-Controleur
- dafür zu sorgen, daß stets ein angemessener Vorrat davon im Magazin vorhanden sei, und auch das Mischungsmaterial zeitig bestellt und angeschafft wurde.
- Von jedem Pfannen-Anteile ist stets 1 oder 2 oder 3 Tonnen gutes Salz, jedoch nur zu 394 Pfd. Gewicht, zum Viehsalz-Magazin zu liefern, hier wird für die ganze Quantität pro Tonne 4 Pfund Wermuth-Pulver und 2 Pfd. Eisen-Oxyd abgewogen und damit das Salz sorgfältig gemischt, wonach alsdann ebenso viel Tonnen à 400 Pfund da sein werden, als Tonnen zu 394 Pfund geliefert wurden.
- über das Viehsalz, die Einnahme und Verwendung an Mischungsmaterial hat der Salinen-Controleur ein besonderes Jahres-Conto nach Formular E zu führen, worin die Einnahme jedes Mal, wenn sie stattfindet, die Ausgabe aber beim Mischungsmaterial allemal bei der Vermischung, die Viehsalzausgabe jedoch nur in Monatsbeiträgen nach den Abschlüssen des Verkaufsregisters eingetragen wird.
§ 11: Alles Salz an die Faktoreien und die königlichen Sellereien muß plombiert werden, sowohl das Vieh- als das Kochsalz. Der Salinen-Controleur ist verpflichtet, insofern er den Verschluß der Säcke und die Plombierung nicht selbst vornehmen kann, dafür zu sorgen, daß solches gehörig und nach der dazu von der königlichen Faktorei erteilten Anweisung verrichtet, auch dabei mit dem Verpackungs-Material wirtschaftlich umgegangen werde.
§ 12 Beim Salz-Verkauf und der Salzversendung leisten in jedem Magazin die betreffenden Salinenarbeiter die nötige Arbeitshilfe zum Einsacken, Verwiegen und Transportiren; der Salinen-Controleur ist aber dafür verantwortlich, daß richtig gewogen, kein unreines Salz beigemengt wird, und untaugliche Stücke, welche sichtlich schlecht und unhaltbar sind, zur Salzversendung nicht verwendet werden. Auch darf feuchtes unausgelagertes Salz nicht zum Verkauf oder zur Versendung gelangen. Der Salinen-Controleur hat ferner für Erhaltung der Brauchbarkeit und Empfindlichkeit der Waagen und die Richtigkeit der Gewichtsstücke bestens zu sorgen, damit einer Seits das Publicum nicht benachteiligt werde, und andererseits die Interessenschaft durch den Gewichtsausschlag nicht zu viel einbüße.
§ 13 Es ist darauf zu achten, daß beim Auswiegen des Salzes das Publicum nicht in die Magazin-Räume dringe; auch darf nicht geduldet werden, daß sich, wie wohl geschehen, die Salinen-Arbeiter von den Salzverkäufern und Fuhrleuten auf Branntwein oder andere Art traktieren lassen, oder Geschenke von denselben annehmen. Dagegen soll den Salinen-Arbeitern gestattet sein, den Fuhrleuten, wenn diese es verlangen, beim Aufladen des Salzes zu helfen oeder solches allein zu verrichten. Die Interessentschaft erlaubt ihnen dafür eine Vergütung von den Fuhrleuten in Anspruch zu nehmen, jedoch von nicht mehr als Drei Pfennigen pro Sack.
§ 14 Die Ordnung in welcher, und die Quantität, bis zu welcher das Salz in den verschiedenen Magazinen zur Ausgabe gelangen soll, für welche die alt-hergebrachte Rangen-Bestimmung bei den unmittels gänzlich veränderten Verkehrs- und Absatzverhältnissen nicht mehr ausreichend und passend ist, wird von Monat zu Monat von der Salinen-Deputation nach Maaßgabe der Umstände bestimmt werden, und es darf der Salinen-Controleur ohne Erlaubniß derselben eine Abweichung sich nicht gestatten.
§ 15 Benutzung der Salzabfälle und Controlirung der Verwendung derselben
Es wird aus dem Salz-Schaum, dem Krückenschlamm, der Mutterlauge, deren als Kochsalz nicht weiter zu benutzenden festern und schlammigen Bestandteilen und dem Kehricht aus den Siederäumen und Magazinen, unter Zumischung einer gleichen Quantität Straßenkot, Erde, Steinkohlenasche und Ruß nebst 1/30 tierischem Dünger eine von den Ökonomen sehr gesuchte Salzdüngererde bereitet und à 5 Silbergroschen pro Scheffel verkauft. Der Salinen-Controleur ist verpflichtet, darauf zu sehen, daß
- Die Salz-Abfälle nach Beendigung eines jeden Werks sofort in der angegebenen Weise gemischt und in die unter Mitverschluß der Steuer-Behörde stehenden Behälter gebracht werden; desgleichen ist darauf zu halten, daß die Mutterlauge aus den Pfannen, da sie nicht meher an Fabrikinhaber verkauft werden kann, gehörig unter die Salzabfälle gebracht werde, nicht aber unverwertet wegfließe.
- Dass die Salz-Abfälle kein kristallisiertes Salz, und überhaupt keine noch auf Kochsalz zu verwendende Salzteile mehr enthalten; es muß daher nach dem letzten Auszuge eines Werkes die Mutterlauge möglichst rein ausgefischt werden, und ist das ausgefischte Salz, wenn solches wegen seiner Eigenschaft und Farbe zur Aufnahme ins Magazin nicht geeignet befunden wird, in der Soole aufzulösen.
§ 16 Die Salzdüngererde wird auf Ausgabe-Schein der Faktorei nach dem auf denselben seitens des die gemeinschaftliche Kasse führenden Salinen-Deputierten die Zahlung des Erlöses vermerkt ist, verausgabt; die Vermessung geschieht in halben Scheffeln Strichmaß; Übermaß darf nicht bewilligt werden. Der befugte Salinen-Deputierte führt das Ausgabe- und Geld-Einnahme Register und hat dabei zu bestimmen, in welcher Reihenfolge und zu welchen Beträgen die Ausgabe aus jedem Salzdüngererde-Behälter zu geschehen hat.
Der Salinen-Controleur sammelt die Ausgabe-Scheine, und hat über die Bereitung und den Abgang der Salzdüngererde ein Conto nach Formular D zu führen, um jeder Zeit eine Übersicht des Zustandes der Bestände vorlegen zu können.
§ 17 Abfertigungs-Kunden
Die Abfertigung des Publikums, sowohl in Bezug auf Verkauf als Versendung darf nur in den Tagesstunden in den Sommermonaten März bis September Vormittags von 7-12 Uhr, nachmittags von 2-6 Uhr, in den Wintermonaten October bis einschließlich Februar vormittags von 8-12 Uhr, nachmittags von 1-5 Uhr stattfinden; die Reihenfolge der Abfertigung richtet sich nach der Nummernfolge der Wiegezettel und Ausgabescheine; wenn gleichzeitig mehrere Fuhrleute zur Abfertigung erscheinen, so ist mit billiger Rücksicht auf begründete Wünsche zu verfahren; jedenfalls muß aber, wenn Salzkäufer und Ankäufer von Düngererde gleichzeitig Abfertigung verlangen, zunächst der erstere befriedigt werden.
Abtheilung 2: Ueberwachung des Verkehrs auf der Saline und in den Siedehäusern (§ 18)
§ 18: Der Salinen-Controleur hat den Verkehr auf der Saline im Allgemeinen, so wie den Verkehr in den Siedehäusern zu überwachen, theils um Unordnungen abzustellen, theils um Soole- und Siedediebstählen und Veruntreuungen vorzubeugen, respective solche zur Entdeckung und Bestrafung zu bringen.
Zu dem Zweck muß er täglich zweimal, jedoch zu unbestimmten Zeiten, besonders oft früh Morgens und Abends spät, in jedes Siedehaus hinein und durch den Pfannenraum hindurch gehen. Die Siedeknechte sind angewiesen, ihm auf Anruf die etwa von einem verschlossene Thür zu öffnen. Er hat bei dieser Revision darauf zu sehen, ob die Salinen-Arbeiter, je nachdem es der Betrieb erfordert, anwesend, in Tätigkeit und nüchtern sind, ob fremde, nicht zu dem Salinen-Personal oder den Familien gehörigen Leute sich darin aufhalten, und nach den Anzeichen zu forschen, welche auf beabsichtigte Veruntreuungen zu schließen Veranlassung geben.
Dabei ist mit Besonnenheit und ohne sich mit den Arbeitern in Unterredungen oder Nachfragen, Erläuterungen oder Ermahnungen einzulassen, zu verfahren, vielmehr sind die etwaigen Vorerfassungen vor dem Arbeitspersonal geheim zu halten; dagegen jede vorgefundene Unordnung, Nachlässigkeit, sowie jeder verdächtige Umstand lediglich in einem über diese Dienstleistung zu führende Tagebuch zu vermerken. Dieses Tagebuch oder Notiz wird in monatlichen Abschnitten geführt und am Monatsschlusse der Salinen-Deputation vorgelegt, welcher lediglich anheim gestellt bleibt, ob und in wie fern dessen Inhalt zu weiterer Verfolgung Grund darbietet. Sind die vorgefundenen Ungehörigkeiten aber der Art, daß ihre schleunige Beseitigung nöthig wird, oder ist die Dringlichkeit eines Verdachts augenfällig, so ist davon der Salinen-Deputation sofort schriftlich Anzeige zu machen.
In Bezug auf Soole- und Kohlendiebstähle ist die Ueberwachung dahin auszudehnen, daß die Behälter für beide sich, zumal bei Nacht, unter sichernden Beschluss und in angemessener baulicher Festigkeit befinden.
Abtheilung 3: Ueberwachung der Salinenarbeiter in Bezug auf die denselben in ihrer Instruction auferlegten Dienstleistungen (§ 19)
§ 19 Dem Salinen-Controleur wird eine Abschrift der Instruction für die Siedearbeiter, wenn eine solche statt derjenigen vom 25ten Februar 1841, welche nur fir die Dauer der damaligen Contractsperiode beschlossen wurde, also bereits seit 1851 keine Gültigkeit mehr hat, erlassen oder die alte erneuert werden sollte, seiner Zeit mitgeteilt werden, und es liegt ihm alsdann auch die Verpflichtung ob, darauf zu achten, ob dieselbe befolgt wurde, und Zuwiderhandlungen der Salinen-Deputation zur Anzeige zu bringen.
Es wird jedoch ausdrücklich hervorgehoben, daß die Salinen-Arbeiter im Allgemeinen nur ihren Herrschaften Gehorsam schuldig und verantwortlich sind. Zwischen ihnen und dem Salinen-Controleur findet ein Subordinationsverhältnis nicht statt. Es liegt aber im Wesen und in der Natur des Geschäftsvertrages auf der Saline, daß die Salinen-Arbeiter, wenn der Salinen-Controleur sie zum Zwecke der Salzverwiegung und Verpackung zum Transport von Salz in das Siedesalz-Magazin, zur Vermischung desselben, zum Mischen und Vermessen von Salzdüngererde, so wie auch zum zweimaligen Probieren der gewerkschaftlichen Brandspritzen aufruft und beordert, schuldig sind, ungesäumt Folge zu leisten. Selbstredend ist dabei unvermeidliche Verhinderungen und Abhaltungen geeignete Rücksicht zu nehmen, unbegründetes Ausbleiben oder Versäumnisse aber unverweilt zur Anzeige zu bringen.
Abtheilung 4: Spezielle Ueberwachung der gemeinschaftlichen Brunnen, Soole-Leitungen und Inventarstücke (§§ 20 – 22)
§ 20 Dem Salinen-Controleur wird zur Pflicht gemacht, die Bohr-Quellen No. 1 und 2, die Brunnen, Brunnenhäuser und Soleleitungen, desgleichen sämtliche Inventarien-Stücke unter spezielle Aufsicht zu nehmen.
§ 21 Zu dem Zweck soll zunächst ein neues Inventarium der im gemeinschaftlichen Besitz befindlichen Grundstücke, Brunnen, Bohrlöcher, den dazu gehörigen Gebäuden, Rohrleitungen, Sammlungs- und Verteilungs-Vorrichtungen und der gemeinschaftlichen Inventarstücke als Bohr-Instrumente, Förderungsvorrichtungen, Feuerlösch-Geräte, Waagen, Gewichtstücke pp aufgenommen und festgestellt werden.
Dieses Inventarium wird in Abschrift dem Salinen-Controleur zur Fortführung übergeben. Derselbe hat den Zustand der einzelnen Stücke von Zeit zu Zeit genau nachzusehen, kleinere Reparaturen sofort zu veranlassen, auch die Eichung und Prüfung der Waagen und Gewichtstücke nach Erforderniß zu besorgen, die Kosten davon vierteljährlich zu liquidieren und die speziellen Liquidationen der Salinen-Deputation zur Prüfung, Attestierung und Anweisung vorzulegen, worauf die Zahlung aus der gemeinschaftlichen Kasse erfolgt.
Insbesondere aber ist das Brunnenhaus der Bohrlochquelle No. 1, die Röhrenfahrt von derselben zum Verteilungskasten und dieser selbst unter der genauesten Aufsicht zu halten, deren Zweck dahin gerichtet sein muß, daß der Soole-Zufluss in der Betriebszeit keine Störungen erleide und stets in ausgiebigem Maße vorhanden sei.
Das Brunnenhaus muß unter Verschluß gehalten werden und der Verteilungskasten neben dem Maschinenhause behufs Entfernung und Wiederverstopfung der Abflußröhren zwar leicht zugänglich sein, allein danach gegen mutwillige Beschädigung durch Unrath und Steine möglichst gesichert sein.
Entstehende Mängel, besonders an der Röhrenleitung, sind beim Beginn, wo es meistens mit geringen Kosten und rasch geschehen kann, abzustellen. Größere Reparaturen und teilweise Erneuerungen müssen zeitig vorgesehen voraus veranschlagt und überlegt werden und dürfen erst auf Order der Salinen-Deputation, nach eingeholtem Beschluß der Interessentschaft, zur Ausführung gebracht werden; es ist dazu eine Jahreszeit zu wählen, worin der Betrieb der Soole-Förderung ohne erheblichen Nachtheil gestundet werden kann; auch ist dem einzelnen Interessenten der unvermeidliche Eintritt einer solchen Störung etwa 4-6 Wochen vorher anzukündigen, damit ein jeder sich mit dem Förderungs- und Gradierungs-Betriebe darnach einrichten kann.
Die Brandspritzen sind zweimal des Jahres zu probieren und gründlich nachzusehen, auch für die Reparatur vorkommenden Falls sofort Vorkehrungen zu treffen, damit sie zu jeder Zeit sich in dauerhaft brauchbarem Zustande befinden.
§ 22 Die Functionen der in den letzten Jahren durch besondere Contracte angenommenen Brunnen- und Spritzenmeister hören bei der definitiven Anstellung des Salinen-Controleurs auf; es fallen daher auch die dafür gezahlten besonderen Löhne aus. Letzterer hat diese Functionen, ohne dafür eine besondere Vergütung zu gewärtigen, mit zu übernehmen; er kann aber bare Auslagen für Material und Arbeitslohn zur Erstattung liquidieren.
– – – –
Vorstehende in der Konferenz des Sälzer-Kollegs vom 15.d.M. nach einem vom königlichen Salzfactor Weierstraß vorgelegten Entwurf beratenen und besprochenen Instruktion wird in der gegenwärtigen, in Berücksichtigung aller der der über verabredeten Änderungen abgefassten, neuen Redaktion allerseits genehmigt.
Westernkotten, den 28. Mai 1856
Gesehen und für den landesherrlichen Antheil der Saline Westernkotten genehmigt. Bonn, den 12.July 1856
Königlich-Preußisches-Rheinisches-Ober-Berg-Amt
Gez. Decken gez. Schwarze
gez. Geisler namens des Herrn Graf v. Landsberg-Velen und unter Vorbehalt zu jeder Zeit freistehenden Abänderung der vorstehenden Instruction, durch gemeinschaftlichen Beschluß der Interessentschaft
gez. Gordes namens des Herrn von Papen
gez. D. Bredenoll II
gez. Hake, Bevollmächtigter der Erben Anton Bredenoll
gez. R. Jesse
gez. A. Jesse
gez. Löper
8.3. Die Arbeiter auf der Saline Westernkotten
Für den Untersuchungszeitraum lassen sich folgende Beschäftigtenzahlen für die Saline Westernkotten ermitteln [Akte 13 des Salinen-Depositums und für 1861: Statistische Darstellung des Kreises Lippstadt, aaO S.57f]
| Jahr | Anzahl der Arbeiter | Familienangehörige |
| 1816 | ||
| 1817 | ||
| 1818 | ||
| 1819 | ||
| 1820 | ||
| 1821 | 40 | 94 |
| 1822 | 40 | 94 |
| 1823 | ||
| 1824 | ||
| 1825 | ||
| 1826 | ||
| 1827 | ||
| 1828 | ||
| 1829 | ||
| 1830 | 58 | |
| 1831 | ||
| 1832 | 58 | |
| 1833 | 58 | |
| 1834 | 58 | |
| 1835 | 57 | |
| 1836 | 54 | 182 |
| 1837 | 55 | 188 |
| 1838 | 53 | 177 |
| 1839 | 53 | 172 |
| 1840 | 53 | 174 |
| 1841 | 38 | 136 |
| 1842 | 40 | 140 |
| 1843 | 38 | 136 |
| 1844 | 34 | 125 |
| 1845 | 34 | 120 |
| 1846 | 23 | 88 |
| 1847 | 23 | 90 |
| 1848 | 23 | 83 |
| 1849 | 23 | 83 |
| 1850 | 22 | 86 |
| 1851 | 23 | 91 |
| 1852 | 23 | 91 |
| 1853 | 22 | 97 |
| 1854 | 20 | 89 |
| 1855 | 17 | 74 |
| 1856 | 16 | 68 |
| 1857 | 18 | 78 |
| 1858 | 18 | 81 |
| 1859 | ||
| 1860 | ||
| 1861 | 22 | 66 |
| 1862 | ||
| 1863 | ||
| 1864 | ||
| 1865 | ||
| 1866 | ||
| 1867 | ||
| 1868 | ||
| 1869 |
Vergleicht man die Zahl der Arbeiter auf verschiedenen westfälischen Salinen für das Jahr 1821, so ergibt sich folgendes Bild:
Königsborn 195 Arbeiter
Neusalzwerk 49
Sassendorf 20
Gottesgabe 20
Salzkotten 34
Westernkotten 40 Amtsblatt Regierung Arnsberg 1822, S. 317]
Für einzelne Jahre liegen noch nähere Angaben über die Beschäftigten auf der Saline Westernkotten vor:
1830: Von den 58 Beschäftigten waren 21 bei von Landsberg, 12 bei von Papen, 5 bei den Gebrüdern Bredenoll, 6 bei den Gebr. Jesse, 7 bei Löper, 1 bei den Erben Vernholz und 6 beim Königlichen Anteil beschäftigt.
1845: Von den 34 Beschäftigten waren 17 bei von Landsberg (davon 2 Brunnenmeister, 4 Brunnentreter, 6 Sieder, 2 Gradierer, 3 Hilfsarbeiter), 4 bei von Papen (2 Sieder, 1 Gradierer und 1 Hilfsarbeiter), 2 bei den Gebrüdern Bredenoll (Sieder und Hilfsarbeiter), je 2 bei Jesse und Löper (Sieder und Hilfsarbeiter), 4 beim Königlichen Anteil und 3 gemeinschaftlich Beschäftigte (1 Salzwieger, 2 Pfannenschmiede) beschäftigt.
1853: Die 22 Arbeitskräfte setzen sich aus 4 Gradierern, 12 Siedern und 6 Hilfskräften zusammen.
1855: Für dieses Jahr liegt eine Namensliste der 17 Arbeitskräfte vor:
Sieder:
Peter Hasel, 47 Jahre
Bernhard Steins, 51
Anton Otto, 36
Joseph Rath, 40
Joseph Rieke, 68
Joseph Erdmann, 47
Joseph Hilwerling, 45
Caspar Spiekermann, 54
Theodor Dabrock, 34
Franz Späthmann, 34
Georg Rittelmeier, 60
Gradierer:
Johannes Hense (auch Salinen-Kontrolleur), 40
Adam Dietz, 54
Anton Cramer, 46
Friedrich Jesse, 50
Johannes Schäfermeier, 45
1858: Auch für dieses Jahr liegt eine Namensliste der 18 Beschäftigten vor, von denen drei als „zeitweise Arbeiter“ geführt sind.
1864: Nach einem Einwohnerverzeichnis aus dem Jahre 1864 [vgl. Marcus, in: Heimatblätter 1993, S. 97-101] werden folgende Einwohner (Hausvorstände) Westernkottens genannt, deren Berufe unmittelbar mit der Saline in Verbindung standen (in Klammern der heutige Wohnstandort) :
1 Salinenkontrolleur: Johannes Hense (Aspenstraße 24)
1 Oberkontrolleur: Ludwig Zumpfort (Aspenstraße 8)
1 Steueraufseher: Bernhard Bollmann (Nordstraße 1)
1 Aufseher: Julius Schwendig (Osterbachstr.1, heute Dorfbrunnen)
2 Magazinaufseher: Heinrich Groß (Aspenstraße 1)
Anton Beberdick (Bredenollgasse 6)
8 Salzsieder: Theodor Dabrock (Aspenstraße 12
Franz Erdmann (Aspenstraße 11)
Franz Hense-Hirz (Stadtgasse 4)
Joseph Duwentester (Wolfsangel 1)
Anton Finkeldey (Wolfsangel 3)
Joseph Rath (Zur Landwehr 2)
Joseph Erdmann (?)
Joseph Hilwerling (?)
2 Gradierer: Anton Kramer (Bruchstraße 23)
Fritz Jesse (Nordstraße 1)
9. Salzdiebstähle und Salzschmuggel
9.1. Salzveruntreuungen und Salzschmuggel in der Saline Westernkotten
Besonders die Preiserhöhungen des Jahres 1820 führten zu einem starken Anstieg des Salzschmuggels in Westfalen. „Im Herbst 1820 drohte die Bezirksregierung, diejenigen Gemeinden, die zu wenig Salz bezogen, der Salzkonskription, also einer Salzverbrauchskontrolle, zu unterwerfen [Jarren S. 271]. Auch in weiten Teilen des Kreises Lippstadt einschließlich Westernkotten wurde sie dann tatsächlich eingeführt, und zwar vom 1.1.1826 bis zum 1.3.1843 [ebd. S. 284]. Der Minderverbrauch in diesen Gebieten basierte sicherlich im Wesentlichen nicht darauf, daß aus dem Ausland Salz ins Land geschmuggelt wurde, sondern durch Salzveruntreuungen auf den Salinen, für unseren Raum die Saline Westernkotten, der Markt beeinflußt wurde.
Der Salzfaktor Weierstraß hat dazu kurz nach seinem Dienstantritt Ende 1839 eine Akte [Depositum der Pfännerschaft, Akte 34] mit dem Titel „Acta betreffend die Maaßregeln zur Verhütung und Entdeckung der Salzveruntreuungen durch zweckmäßige Controllirung der Salinen-Arbeiter“ angelegt. Die Akte beginnt mit einem 8-seitigen Brief von Weierstraß an das Oberbergamt in Bonn vom 29.8.1840, das aufgrund seiner grundsätzlichen Erwägungen vollständig wiedergegeben wird:
„Über die Salzveruntreuungen der Siedeknechte bei hiesiger Saline, und die Mittel, den Unfug zu hemmen.
Eine sorgfältige Beachtung des Salz-Debits bei hiesiger Factorei und Vergleichung derselben mit der Seelenzahl hat mich sehr bald nach dem Antritt meines Dienstes hier zu der Vermuthung geführt, daß viel Salz auf unerlaubten Wegen ins Publicum gelangen mußte, da der Debit gegen den Bedarf nach der Seelenzahl bedeutend zurückbleibt. Von heimlicher Salzbereitung aus gestohlener Soole rührt dies nicht her; wenigstens habe ich bis jetzt noch keine Spur davon entdeckt. Verschiedene bedeutende Beschlagnahmen der Steuer-Beamten und die allgemeine Stimme des Publicums aber deuten darauf hin, daß das Salz, welches den Gegenstand des heimlichen Salzhandels ausmacht, unmittelbar aus den Siedehäusern ins Publicum gelange. Diebstahl aus den Magazinen könnte nur unter Anwendung gewaltsamer Mittel vollführt werden, wovon man keine Spuren hat.
Es kann daher angenommen werden, daß es aus den Siederäumen und Pfannen entnommen wurde. Die in Beschlag genommenen Quantitäten bestanden alle aus Salz vom 2ten Auszuge einer Pfanne, und das Gewicht der einzelnen Packen war das durchschnittliche vom Inhalt eines der Körbe, worin das Salz aus den Pfannen eingefüllt wird. Salz vom 1ten Auszuge ist unter solchen Beschlagnahmen noch nicht vorgekommen, weil der 1te Auszug durchgängig unmittelbar aus der Pfanne in die Magazine oder auf die Trockenböden gebracht wurde. Hieraus ergibt sich, daß die Sieder es sind, durch welche das Salz veruntreut wird, indem sie es heimlich zu geringeren Preisen verkaufen.
Nachdem ich über diesen Unfug, wodurch das Salzregal so erheblich beeinträchtigt worden, möglichst genaue und umfassende Erkundigungen eingezogen, habe ich dieserhalb der vorgesetzten Debits-Verwaltungs-Behörde ausführlichen Bericht erstattet, und dargetan, welchen Umfang der heimliche Salzhandel hat, daß oft 20 Tragen in einer Nacht expediert werden, und so auch die Debitsnotizen nachweisen, wie in der Umgebung der Saline bis auf 2-3 Stunden mit jährlich 200-300 Pfannen Salz mehr consummirt als debitirt wurden, wodurch eine Steuer-Einbuße von jährlich nahe 3000 Reichstaler entsteht.
Die Möglichkeit des Uebels liegt in den Lokal-Verhältnissen. Die Saline bildet kein geschlossenes Ganzes; es sind 9 einzelne Siedehäuser da, welche voneinander getrennt liegen, von allen Siedern zugänglich und daher schwer zu bewachen sind. Zur Vorbeugung und Verhinderung der Veruntreuungen ist bisher nichts Durchgreifendes geschehen; eine technische Kontrolle findet nicht statt; man kennt weder den kubischen Inhalt der Siedepfannen genau, noch sind Vorrichtungen, um die Siede-Soole in die Pfannen hinein zu messen; die Hüttenknechte sind sich beim Siedebetriebe fast durchgehend selbst überlassen; und in mehreren Hütten wird es sogar geduldet, daß sie bei Nacht ohne alle Aufsicht arbeiten, welches die Folge hat, daß sie zu den beschwerlicheren Arbeiten Hülfsarbeiter auf eigene Kosten nehmen, welche, wie sich leicht denken läßt, ihre Vergütung in Salz erhalten, und die nun noch dazu die schönste Gelegenheit finden, davon außerdem zu stehlen.
Darim gibt es unter den geringen Tagelöhnern hier auch viele, welche einen heimlichen Handel mit Salz im Kleinen betreiben und selbst größere Quantitäten nach den benachbarten Orten hinbringen und damit hausieren.
In dem erwähnten Bericht habe ich verschiedene, seitens der Salz-Debits-Verwaltung anzuordnende Hemmungs- und Schutzmaßnahmen vorgeschlagen, und dabei darauf aufmerksam zu machen mir erlaubt, wie es mir nötig erschien, dass die Gewerkschaft angeregt werde, die zu treffenden Maßregeln durch Anordnungen ihrerseits zu unterstützen, welche meines Dafürhaltens darin bestehen dürften:
- Das sämtliche Siedeknechte gerichtlich vereidet würden, nach § 17 der Sälzer-Artikel, indem die meisten noch nicht vereidet sind.
- daß ihnen angedeutet werde, wie ihr Dienstverhältnis auf Kündigung beruhe, und sie daher wie alle sonstigen Domestiken nach Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist entlassen werden können. Die Siedeknechte stehen hier nämlich alle in der Meinung, daß sie von ihren Herrschaften so lange nicht entlassen werden könnten oder würden, als ihnen nur Veruntreuung nicht förmlich bewiesen würde, eine Ansicht, welche eine Folge des Verhältnisses ist, daß 12/15 der Saline nicht von den Interessenten selbst, sondern von Verwaltern administriert wird.
- daß die nächtliche Arbeit in den Siede-Anstalten, und die Annahme von Hülfsarbeitern ohne Erlaubniß der Interessenten durchaus nicht geduldet werde. Nach der Ansicht hiesiger Salzkundiger ist es überall kein Bedürfnis.
- daß zum gewerkschaftlichen Salzwieger ein tüchtiger, wo möglich mit der Interessentschaft nicht in naher Verwandtschaft stehender Mann von anerkannt redlichem und festem Charakter angestellt, diesem auch eine Art von Kontrolle über die Salinen-Arbeiter zu besondern und Überwachung derselben zur Verhütung und Entdeckung von Veruntreuungen auferlegt, daß solcher mit einer ausführlichen, den obwaltenden Verhältnissen entsprechenden Dienst-Instruktion versehen, aber auch ausreichend besoldet werde, etwa mit 240 Reichstaler jährlich, damit er sich lediglich seinem Dienste widmen kann, und nicht zu Nebengeschäften seine Zuflucht nehmen müßte. Die beste Gelegenheit einzuwirken, ist gegenwärtig vorhanden, da der bisherige Salzwieger Brinkmann am 22.d.Monats mit dem Tode abgegangen ist.
- daß auf die Ermittlung der Salz-Veruntreuung, wenn der Fall der Art ist, daß der betreffende Siedeknecht zur Bestrafung gezogen werden kann, eine namhafte Prämie gesetzt werde, und
- daß endlich auch eine gehörige technische Kontrolle des Salinen-Betriebes ausgeführt werden möge.
Obgleich ich bei Leitung und Beaufsichtigung des Produktionsbetriebes beim landesherrlichen Anteile noch keine Spur aufgefunden, welche mich veranlassen könnte, die Redlichkeit des Sieders Rittelmeier in Zweifel zu ziehen, so ist es mir doch auch nicht möglich gewesen, die gewisse Überzeugung zu erhalten, dass das bei jeder Siedung gewonnene Salz wirklich alle zum Magazin gelange, und nicht währen der Soggezeit davon entwendet wurde.
Die geführt werdenden Notizen über Soole-Förderung, Gradierung und Verwendung bieten nur Hülfsmittel untergeordneter Art da, welche umso weniger sichere Anhaltspunkte zur Berechnung des Ertrages darbieten, weil die Ermittlung des Soole-Volumens in den Reservoiren durch Messung der Tiefe unsicher und ungenau ist, und selbst die Bestimmung des Prozentgehaltes der Soole durch die einzige hier vorhandene Salzspindel, die schon seit vielen Jahren im täglichen Gebrauche des Siedens und bereits mehrmals repariert worden, ebenso unzuverlässig erscheint.
Bisher habe ich nur Gelegenheit gehabt, in Bezug auf technische Kontrolle, bei dem Verwalter der Saline Sassendorf einige Erfahrungen einzuziehen, allein auch dort keine mir geeignete Erfahrung erhalten.
Es wäre mir daher außerordentlich angenehm, zu erfahren, welche Mittel man bei den königlichen Salinen zu Königsborn und Neusalzwerk verwendet, um den Vollertrag jeden Werkes im Voraus festzustellen. Dadurch allein dürfte die Überzeugung und Redlichkeit der Sieder zu gewinnen und gegen Veruntreuungen am besten vorzubeugen sein.
Bei hiesiger Betriebsweise müßte ich mir dadurch zum Zwecke gelangen, daß ich von Anfang einer Siedung bis zum letzten Auszug einer Pfanne beständig gegenwärtig bleibe, oder in den Ruhestunden den Siederaum unter Verschluß legen, und demnächst jedes Werk besonders verwiegen ließe, ein Verfahren, welchen sich aber nicht ausführen ließe.
Um auf anderem Wege den Zweck zu erreichen, z.B. durch Einmessen der Siedefülle in die Pfanne oder Messung des Volumens der garen Soole und genaue Bestimmung ihres Prozentgehaltes auf einer Normal-Temperatur – dazu fehlen die Vorrichtungen, Meßaggregate und amtlich festgestellte Reduktions- und Nachwiege-Tabellen. Sehr gern und mit Vergnügen würde ich alle mögliche Mühe verwenden, um dem herrschenden Unfug und Schlendrian entgegen zu wirken, und bitte daher gehorsamst um hochgeneigte Erteilung einer Anweisung, wie hier eine bessere technische Controlle ein- und durchzusetzen sein wird. In den genannten Verhältnissen finde ich zudem eine dringliche Veranlassung, der Gewerkschaft hier durch persönliche Berechnungen zu zeigen, was bei ernstlichem Willen durch eine gute technische Aufsicht geleistet werden kann. Endlich erlaube ich mir noch, den Wunsch auszudrücken, mir hochgeneigtest eine praktische Schrift über Salinen-Kunde, woraus ich weitere Belehrung schöpfen könnte, zur Anschaffung zu empfehlen. Weierstraß“
Das königliche Oberbergamt setzt sich daraufhin mit dem Finanzamt/Steueramt in Münster in Verbindung und schickt Weierstraß auch eine Stellungnahme aus Königsborn zu, wie dort das Problem von Salzveruntreuungen behandelt wird. An Fachliteratur wird ihm die 8. Auflage von K. C. Langsdorffs „Salzwerkskunde“, Heidelberg 1824, empfohlen.
Über den richtigen Weg zur Minderung der Salzveruntreuungen wird in den nächsten Monaten und Jahren heftig gestritten [hier können nicht allen Einzelheiten der Akte wiedergegeben werden.]. 1842 kommt es dann sogar zu einem sehr einschneidenden Beschluß: Falls kein Siedeknecht einen Salzdiebstahl zugibt, soll durch Losentscheid ermittelt werden, wer fristlos entlassen wird! Hier drückt sich nicht nur Rigorismus, sondern auch eine gewisse Hilflosigkeit aus.
Aber auch diese Regelung hatte keinen besonderen Erfolg. Denn die Akte 34 endet mit einem Schreiben des Oberbergamtes vom 17.11.1846 an Salzfaktor Weierstraß: „Wir erwidern Ihnen auf den Bericht vom 6ten v.M., aus dessen Anlage wir ersehen haben, da die Salinen-Interessenten in ihrer Konferenz vom 23ten Oktober die im Jahre 1842 beschlossene Maßregel der Entlassung der Siedeknechte durch das Loos bei Salzdiebereien als unausführbar wieder aufheben zu wollen beschlossen haben, daß wir dem darselbigen Beschlusse unsererseits beitreten und den Herrn Provinzial-Steuer-Direktor heute davon benachrichtigt haben.“
Eine systematische Darstellung aller Salzveruntreuungen kann aufgrund der vorgestellten Sachlage nicht geleistet werden. Im Nachlaß Eickmann [Depositum 2 im Stadtarchiv Erwitte, Nr.36] befindet sich allerdings eine dünne Akte über Salzdiebstähle 1851 und 1852; darin wird erstmals ein konkreter Einzelfall geschildert, in diesem Fall ein Diebstahl aus einem der Salzmagazine. Die Akte beginnt mit einem Ermittlungsprotokoll des Salzfaktors Weierstraß vom 27.Dezember 1951. Es zeigt anschaulich, welche Sicherheitsvorkehrungen gegen Diebstahl getroffen wurden und wie allergisch die Steuerbehörde darauf reagierte. Das Protokoll wird im Folgenden komplett wiedergegeben:
„Westernkotten, den 27. December 1851
Der Salzmagazin-Aufseher Karges zeigte an: Von der Trockenkammer über dem landesherrlichen Magazin, auf welchem ein Theil des Salzes vom letzten Werke stehen geblieben war, sind seit Mittwoch, den 24ten d.M., abends 30 Körbe Salz gestohlen worden; die leeren Körbe liegen zerstreut auf der Trockenkammer umher; der steuerliche Verschluß, von mir selbst am Abend des 24ten angelegt, ist nirgends verletzt, und bis diesen Augenblick eine Öffnung oder der Weg, den die Diebe genommen haben mögen, nicht ermittelt.
Nachdem hiervon der Ortspolizei sofort Anzeige gemacht worden war (die Anzeige ist schriftlich in secundo gemacht), begab sich der unterzeichnete Salzfaktor in Begleitung des Ortsvorstehers Hense und der beiden Magazinaufseher in das landesherrliche Siedehaus, um den Tatbestand näher zu ermitteln.
Zunächst wurde der Sieder Rittelmeier befragt, was ihm von der Sache bekannt geworden, und ob er, was vorgeschrieben, die Nacht im Siedehause geschlafen habe. Er erwiderte: Ich habe den Diebstahl erst diesen Morgen beim Öffnen der Magazine zum Auswiegen bemerkt. Sobald ich auf die Trockenkammer kam, sah ich verschiedene leere Salzkörbe umher liegen, und die sichtlichen Spuren, dass solche auf der Trockenkammer ausgeleert worden waren; ich kann mit Bestimmtheit versichern, daß vom 24ten abends, als ich zuletzt nach der Verriegelung der Wiegekammer-Tür auf der Trockenkammer gewesen, auf derselben nicht ein einziger leerer Korb vorhanden war; beim Nachzählen heute fand ich 30 leere und das Salz daraus verschwunden. Ich habe … auch stets des Nachts in der Hütte geschlafen; zu dem Zwecke gehe ich gegen 9 Uhr abends aus meiner Wohnung, und zu Bette, verlasse auch das Siedehaus in der Regel nicht vor Tages Anbruch, jedoch bin ich am ersten Weihnachtstag morgens 4 Uhr aufgestanden und nach Erwitte zur Frühmesse gegangen.
Wenn der Diebstahl bei Nacht geschehen wäre, so hätte ich wohl irgendein Geräusch vernommen, da ich keinen festen Schlaf habe; ich vermute daher, daß derselbe in den Abendstunden von 5 – 9 bei diesen dunklen Nächten ausgeführt ist.
Der unterzeichnete Salzfaktor und der Gemeinde-Vorsteher Hense überzeugten sich hierauf, daß außer dem auf der Trockenkammer in Körben aufgestellten Salze, dreißig leere Körbe auf derselben verstreut umher lagen, daß sichtlich Salz darin gewesen sei, solches noch auf der Trockenkammer daraus geschüttet worden sei, wie die Verstreuungsspuren zeigten, und mithin eine Salz-Entwendung von etwa 2000 Pfund stattgefunden habe.
Es war nirgends eine Öffnung oder Thür von gewaltsamer Erbrechung der Trockenkammer aufzufinden; dagegen machte der Sieder Rittelmeier darauf aufmerksam, daß die Krampe an der Trockenkammertür, vermittels derer das Montageschloß angebracht wird, wie er diesen Morgen gehört, mit Manneskraft sich ausziehen lasse. Es ergab sich dies als richtig, auch daß die Spitzen dieser Krampe, welche ohnehin nicht durch den Türpfosten durchgehen, im Holze abgebrochen waren; auch zeigte es sich deutlich, daß die Krampe schon früher als heute mußte losgerüttelt worden sein, weshalb anzunehmen ist, daß die Diebe das Vorlegeschloss vermittels eines Nachschlüssels geöffnet oder vermittels des Schlosses selbst die Krampe ausgezogen haben; die Sorgfalt aber, womit die Krampe wieder befestigt wurde, deutet darauf hin, daß die Diebe mehrere Abende hintereinander in dem Siedehause gewesen seyen, und nicht wieder Willens waren, im Vertrauen darauf, daß heute, also an einem Lokal-Feiertage, Öffnung der Magazine nicht stattfinden werde, noch heute und morgen Abend wieder zu kommen.
Es ergab sich nun bei fernerer Nachsuchung, daß die Diebe durch den Feuerungszug, dessen Doppeltüren mit Vorlegeschloss versehen sind, eingedrungen sind; das Vorlegeschloß an der nördlichen Doppeltür war verschwunden; in der Asche befanden sich eine Menge Fußspuren; die Roststäbe von der einen Schürtüre wurden losgebrochen, und dadurch eine Oeffnung gemacht, um durch die sich leicht öffnende Thür des Schürloches links in die Heizküche zu gelangen.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben
Salzmagazin-Aufseher Karges
Salzmagazin-Aufseher Glauner
Rittelmeyer
in fidem Weierstraß“
Weierstraß informierte daraufhin nicht nur das Haupt-Steuer-Amt in Paderborn und das Oberbergamt in Bonn, sondern schaltete auch Staatsanwalt Günther aus Lippstadt in die Ermittlungen ein.
Da die Recherchen keinerlei Erfolg zeigten, versuchte man es mit einer Suchanzeige: Im Lippstädter Kreisblatt – Gesamtblatt für die Kreise Beckum, Büren, Lippstadt, Meschede, Wiedenbrück – vom 3. März 1852 stellte der Staatsanwalt 50 Taler Prämie für die Ergreifung des Täters in Aussicht.
Aber auch das zeigte keinen Erfolg, vielmehr führt die Akte einen weiteren Einbruchversuch für den 19.oder 20. April 1852 an. Weierstraß kann dazu mit Schreiben vom 22.4.1852 an Staatsanwalt Günther zwar zahlreiche Indizien zusammentragen und nennt auch Namen der vermutlichen Täter, die Akte gibt aber keine Auskunft darüber, ob sich der Verdacht bestätigte.
9.2. Salzschmuggel außerhalb der Saline
Daß Westernkötter Salz auch andernorts Anlaß zum Salzschmuggel gegeben hat, ist unter anderem dem Buch „Versmold. Eine Stadt auf dem Weg ins 20. Jahrhundert“ [von Rolf Westheider, Bielefeld 1994] zu entnehmen. Einleitend dazu sei folgendes vermerkt:
Versmold liegt etwa 70 Kilometer nördlich von Bad Westernkotten, 25 Kilometer westlich von Bielefeld südlich des Teutoburger Waldes an der Landesgrenze Nordrhein-Westfalens zu Niedersachsen. Versmold ist heute vor allem durch Fleischhandel und -produktion bekannt.
Versmold gehörte im Mittelalter zur Grafschaft Ravensberg, die aber bereits 1609 preußisch wurde. Der Ort hatte seit alters her eine Grenzlage: Westlicher und südlicher Nachbar war das Bistum Münster, das erst Anfang des 19. Jahrhunderts zu Preußen kam. Nördlicher Nachbar war das Bistum Osnabrück, das erst nach der Annexion des Königreiches Hannover im Jahre 1866 preußisch wurde.
Die Grenzlage, aber auch die Armut weiter Kreise der Bevölkerung, machten den Schmuggel zu einem einträglichen Geschäft. Dabei spielte der Schmuggel von Salz eine besondere Rolle.
Unmittelbar nördlich von Versmold, aber im Bistum Osnabrück, lag Rothenfelde, wo seit 1728 Salz aus Sole gewonnen wurde. Dieses Salz war bei weitem preiswerter als das Salz in den preußischen Ländern, vor allem deshalb, weil die Sole in Rothenfelde einen sehr hohen Salzgehalt hat und zum anderen bis Versmold nur recht geringe Transportkosten anfielen.
In Preußen, also auch in Versmold, herrschte aber das staatliche Salzmonopol. Das Salz mußte – wie bereits ausgeführt – in eigens dafür angelegten Verkaufsstellen, den Sellereien oder Faktoreien, bezogen werden. Aber nicht nur der Handel, sondern auch der Verbrauch war geregelt. Jeder Privat-Verbraucher musste eine Mindestmenge an Salz pro Jahr kaufen. Nach Westheimer betrug dieses „Obligo-Quantum“ für einen Erwachsenen etwa 12 Pfund pro Jahr. Jeder Haushalt war gehalten, ein Salzverbrauchsbuch zu führen. Wer das nicht tat, wurde als Steuerhinterzieher eingestuft und entsprechend zur Kasse gebeten. Wenn Privatverbraucher ihren Abnahmepflichten nicht nachkamen, mußten in der Regel die Gemeinden die entsprechenden Mengen abnehmen und bezahlen.
Vor diesem nur kurz skizzierten Hintergrund blühte natürlich der Salzschmuggel und war immer wieder Anlaß für Polizeieinsätze und Gerichtsverfahren.
Der nachfolgende Fall aus den Akten des Staatsarchivs Detmold steht beispielhaft dafür. Interessant ist die Tatsache, dass darin nicht nur allgemein vom Preußischen Salz die Rede ist, sondern ganz konkret von den „Westernkottener Salzen“, die in Versmold abgenommen werden mußten. Im übrigen gibt das Polizeiprotokoll einen guten Einblick, wie Salzschmuggel zur damaligen Zeit polizeilich verfolgt wurde.
„Am 20. October 1856 fanden der Steuer-Aufseher Papenmeyer, der Amtsdiener Wilhelm Prange aus Versmold und der Polizeidiener Friedrich Overbeck aus Bockhorst bei dem Heuerling Köhn, Gemeinde Bockhorst, eine Quantität Salz von ungefähr 1 Pfund, welches die Beamten als ausländisches erkannten, und welches derselbe von dem Heuerling Heinrich Krack in der Bauerschaft Hesselteich geliehen haben wollte. Die in Folge dessen angestellte Haussuchung ergab, daß derselbe außer dem gewöhnlichen Vorrathe, bestehend in Westernkottener Salze, auch einen Topf mit anscheinend ausländischem Salz von brutto 8 Pfund besaß, welches in einem Schranke stand. In Bezug auf die Qualität dieses Salzes, welches die Beamten sofort als ausländisches erkannten, stimmt das sachverständige, auf chemischer Untersuchung gründende Gutachten des Apothekers Wünnenberg aus Warendorf, das sich in den angeschlossenen Prozessakten befindet, insoweit überein, dass demselben seine Abstammung von der preußischen Saline Westernkotten mit Bestimmtheit abgesprochen wird. Da nun die Sellerei in Hesselteich, an welche Krack mit seinem Salzbezuge ausschließlich verwiesen ist, nur Salz aus jener Saline debitiert, ist nicht zu bezweifeln, daß das fragliche Salz aus dem benachbarten Auslande, wo der Preis desselben sehr gering ist, hereingeführt worden ist.“ [Westheider, S. 203/204]
Bleibt noch anzumerken, daß Krack trotz Drängens der Provinzial-Steuer-Direktion in Münster vom Vorwurf des Salzschmuggels freigesprochen wurde. „Der wie immer scharfe Druck der Steuerbehörden konnte nicht entsprechend weitergegeben werden, weil man angesichts der verbreiteten Armut nur zu gut wußte, daß das Salz völlig überteuert und für die Minderbemittelten nahezu unerschwinglich war.“ [ebd. S. 204]
10.Der Salzverkauf
Da der Salzverkauf nur direkt auf der Saline bzw. in den staatlichen Faktoreien erfolgte, hatten sowohl der Staat als auch die Sälzer ein deutliches Interesse daran, die entsprechenden Transportwege auszubauen. Gleichzeitig spielten die Transportwege aber auch für die Belieferung der Saline mit wichtigen Rohstoffen, vor allem Holz und ab etwa 1819 Steinkohlen, eine große Rolle.
10.1. Salztransport über Chausseen und Straßen
Vor dem Ausbau von Wasserstraßen, im Falle Westernkottens die Lippe ab 1819 [vgl.10.2.], und der Anlegung von Eisenbahnen, für unseren Bereich die Köln-Mindener-Bahn 1847 und die Verbindung von Hamm nach Kassel, 1850 bis Lippstadt ausgebaut und 1853 komplett fertiggestellt [vgl.10.3.], bildeten Straßen und Wege den wichtigsten Transportweg für das Salz sowie auch die Heranschaffung der benötigten Hilfsgüter, vor allem Holz.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Wegeverbindungen noch in einem bedauernswerten Zustand: Grundlose und holprige Wege behinderten auch den Güterverkehr mit schweren Frachtwagen über Gebühr.
Das preußische Oberpräsidium in Münster ging deshalb schon bald daran, sogenannte Chausseen zu bauen, also befestigte Verbindungsstraßen. Neben dem Hellweg, der wichtigsten West-Ost-Verbindung, wurde schon 1821 der Ausbau der Nord-Süd-Verbindung, der Strecke Erwitte-Lippstadt-Wiedenbrück, als Teilstück der Verbindung Koblenz-Minden, in Angriff genommen. Bereits 1823 war dieses Teilstück, die heutige B 55, fertig, vier Jahre später die ganze Fernstraße [vgl. Junk aaO S.642]
Der Ausbau der Lippe-Schifffahrt bis Lippstadt ab 1819 und die Fertigstellung der genannten Chaussee von Erwitte über Lippstadt nach Wiedenbrück 1823 lösten auch in Westernkotten weitere Aktivitäten im Wegebau, vor allem im Hinblick auf den Ausbau zur Chaussee nach Lippstadt – die heutige Weringhauser Straße bzw. Kurpromenade – aus. So finden sich im Depositalbestand der Saline Westernkotten zwei Akten, die sich mit dem Wegebau beschäftigen. In der Akte 50 geht es im Zeitraum 1829 bis 1851 um die Beteiligung der Saline an Wegebau- und Reparaturkosten, in der Akte 49, den Zeitraum 1825 – 1835 betreffend, um die Beteiligung speziell des landesherrlichen Salinenanteils. Anhand einiger Aktenauszüge und Zusammenfassungen sollen nachfolgend die wichtigsten Entwicklungen aufgezeigt werden.
Aus dem ältesten Aktenstück geht hervor, daß etwa 1824 erste Schritte zum Ausbau des Verbindungsweges vom Dorf Westernkotten zur Chaussee zwischen Erwitte und Lippstadt, also die heutige Weringhauser Straße, unternommen wurden. Mit Datum vom 3.4. 1825 antwortet das Königliche Oberbergamt in Bonn dem Salinen-Deputierten Salzfaktor Brune: „Bevor auf das von Ihnen mittels Bericht de 27ten v.M. vorgelegten Antrag des Ortsvorstandes von Westernkotten wegen Bewilligung eines Beitrages zu der beabsichtigten Anlage eines Communikationsweges zur Chaussee von Erwitte nach Lippstadt, resolviert [= entschieden] werden kann, haben Sie uns anzuzeigen, was andere, vorzüglich die wichtigen, Interessenten der Westernkotter Saline hierfür an Beitrag zu diesem Unternehmen versprochen haben, und zugleich Ihre Vorschläge über den von dem landesherrlichen Antheil gedachter Saline bewilligender Beitrag abzugeben.“
Nach langen und schwierigen Verhandlungen erklärt sich dann das Königliche Oberbergamt mit Schreiben vom 26.1.1830 bereit, 50 Taler zu den Kosten beizusteuern mit dem Bemerken, „daß bei dem hierbei so sehr geteilten Interesse zwischen der Salzdebits- und Salz-Fabrikations-Partie und bei der Weigerung der erstern, hierzu etwas beizutragen, auch seitens der letztern für diesen sonst schon an und für sich sehr lebenswerten Zweck nicht mehr geschehen kann.“ Hier wird deutlich, daß versucht worden ist, auch die Salzdebits-Seite, also das Finanzministerium, an den Kosten zu beteiligen; denn immerhin konnte diese dadurch das Salz durch einen Unternehmer günstiger nach Lippstadt transportieren lassen. Aber die Königliche Regierung in Arnsberg hat – wohl um keinen Präzedenzfall zu schaffen – keine Bereitschaft gezeigt.
Die anderen Salineninteressierten taten sich ebenfalls schwer, einen Anteil zu übernehmen. Mitte 1831 verpflichten sie sich, insgesamt 300 Taler, davon 160 von Landsberg, aufzubringen, aber erst auszuzahlen, wenn der Weg fertig sei.
Aber auch mit der Auszahlung hat es dann noch gedauert. So schaltete sich sogar der Rendant der Gemeinde, Hoffbauer, ein. Er schreibt mit Datum vom 5.12.1832 an das Sälzer-Kollegium: „Da nunmehr der Kommunikationsweg vollendet und wir erst die Hälfte der Verdings-Summe erhalten haben, so ergeht an das löbliche Sälzer-Collegium hieselbst unsere ergebenste Bitte, die baldige Auszahlung der zu dem Wege versprochenen Summe von 300 Reichstalern zur hiesigen Communal-Casse gütigst bewirken lassen zu wollen, da mehrere auch wegen Steinfuhren zu leistende Zahlungen uns sehr in Verlegenheit setzen, und die Kommunal-Casse vorerst noch keine Abschlagszahlungen leisten kann und solcher darauf sofortige extraordinäre Etat von nicht aufgenommenen Zahlungen so sehr in Anspruch genommen ist, daß der und nach Abzug der obigen 300 Reichstaler noch gutbleibende Rest teilweise erst durch die Umlage pro 1833 wird bezahlt werden können.“ Hier wird die prekäre Finanzlage der Gemeinde mehr als deutlich.
Das scheint aber das Sälzer- Kolleg nicht sonderlich berührt zu haben. So schreibt der Sälzer Löper: „Erst nach Vollendung des Weges und nachdem derselbe für gut erkannt ist, bin ich zur Zahlung bereit.“
Erst nachdem auch noch Bürgermeister Schlünder mit Schreiben vom 9.1.1833 eindringlich mahnt, zahlt das Sälzer-Kolleg Mitte Januar seinen Beitrag, also 20 Reichstaler pro Pfannenanteil.
Bereits 1834 ist die Gemeinde dann aber bemüht, auch den weiteren chausseeartigen Ausbau des Weges durch das Dorf nach Süden „bis Wiesen Hof“ [das heutige Anwesen Adämmer-Wuise an der Aspenstraße] zu verwirklichen. Zunächst wollen Rentmeister Erdmann für die Freifrau von Papen und andere nur 10 Reichstaler pro Pfannenanteil dazugeben, aber Rentmeister Brune für den Mehrheitseigentümer von Landsberg setzt 20 Reichstaler pro Pfanne durch. Erdmann stimmt unter der Bedingung zu, „daß die Gemeinde aus ihren disponiblen Mitteln ihre Fußwege, vornehmlich die zum Salzwerk führenden, in brauchbaren Stand setze.“ Auch der landesherrliche Anteil stellt nach Erlaubnis vom Finanzministerium aus Berlin vom 4.5.1834 am 15. Mai 20 Reichstaler für diesen Zweck bereit.
In der Denkschrift zur Errichtung der Rhein-Weser-Eisenbahn vom 18. Juni 1836 [Akte 48 des Sälzerdepositums, S. 28/29] sind unter anderem auch Ausführungen zu den Frachtkosten von Salz auf Wegen und Chausseen gemacht.
Folgendes ist der Quelle zu entnehmen:
- Die Frachtkosten für Salztransporte sind die billigsten, da die Salzabfuhr alljährlich durch Submission vergeben wird, ohne Zulassung von Nachgeboten und zu „ruhigen“ Frachtzeiten.
- Die Fuhrunternehmen erhalten prompte Zahlungen, sobald sie eine Ablieferungsbescheinigung übergeben.
- In der Wahl der Transportzeit sind die Fuhrunternehmen beinahe gar nicht beschränkt.
- Für jedes Fuhrwerk ist stets volle Ladung vorhanden.
- Ein großer Teil der benutzten Fuhrwerke gehört anwohnenden Landleuten.
- Die Höhe der Frachtsätze für die Jahre 1828 – 1835 zu einigen Salz-Niederlagen, die über Chausseen zu erreichen sind, ergibt sich aus der beiliegenden nachfolgenden Tabelle.
- Daraus ergibt sich als niedrigster vorkommender Preis pro Zentner und Meile ein Betrag von 0.65 Sgr.; da Salztransporte wegegeldfrei sind, kommt nur noch ein Chausseegeld pro Zentner und Meile von etwa 0,05 Sgr hinzu, das macht Transportkosten pro Zentner und Meile von 0.7 Sgr = 8,4 Pfennig.
Mit Schreiben vom 24.8.1837 tritt die Gemeinde, diesmal durch den Bürgermeister Schlünder, zum dritten Mal in der Angelegenheit des Wegebaus an das Sälzer-Kolleg heran. Diesmal soll das letzte Teilstück des Weges, also vom Ortseingang beim heutigen Anwesen Adämmer bis zur heutigen Bundesstraße 1, ausgebaut werden; ermittelt sind Kosten von 2000 Reichstalern; der Bürgermeister bittet das Sälzer- Kolleg nochmals um einen Beitrag von 300 Reichstalern; durch die zu Gebot stehenden Hand- und Spanndienste, so der Bürgermeister, könne das Werk nicht vollendet werden. „Es ist zwar schon eine bedeutende Menge Steine zu diesem Wege angefahren, zur kunstmäßigen Bearbeitung derselben und Anlegung des Planums sind aber Geldmittel nöthig, welche gar nicht vorhanden.“ Auch diesen Beitrag hat das Sälzer-Kolleg nochmals aufgebracht, allerdings teilweise mit anderen Auslagen verrechnet.
Die Akte 50 endet mit einem aufschlußreichen Schriftverkehr aus dem Jahre 1951. Zwei Mal, am 15.7. und 2.8., verlangen die Salinen-Deputierten Löper und Gordes schriftlich sehr nachhaltig von der Gemeinde, der Verpflichtung zur Reparatur des Wegestückes zur Chaussee nach Lippstadt nachzukommen,
„widrigenfalls wir uns genötigt sehen, höheren Amts Beschwerde zu führen.“
Das Antwortschreiben des Gemeindevorstehers Franz Hense und des Gemeinderates (Sandhoff, Kemper, Löper(!), Otten, Dicke, Mönnig) an die „löbliche Salinen-Deputation“ vom 28. August 1851 offenbart einen tiefen Einblick in die soziale Kluft zwischen Sälzer-Kolleg und weiten Teilen der anderen Ortsansässigen. Es soll im Folgenden vollständig wiedergegeben werden:
„Die Reparatur des Kommunal-Weges von der Lippstädter Chaussee bis zum Dorfe ist in diesem Jahre unterblieben, weil es der Gemeinde an Mitteln zur Unterhaltung fehlt, und weil bei dem geringen Verkehr und dem leichten Fuhrwerk der Gemeindemitglieder eine Reparatur für diese nicht unumgänglich notwendig erschien. In Beziehung auf die schweren Kohlen- und Salzfrachten ist dieses jedoch ein Anderes. Es ist vorauszusehen, daß für diese Frachten noch vor dem Eintritt des Herbstes eine Reparatur vorgenommen werden muß, wenn der Verkehr nicht stocken soll; weshalb dann auch in dieser Beziehung von den Behörden Erinnerungen gemacht wurden.
Bei der Anlage des Weges, dessen Nützlichkeit gewiß nicht zu verkennen ist, scheinen uns die Gemeinde-Interessen nicht in dem Grade vertreten zu sein als dieses hätte geschehen sollen, indem der damalige Gemeinde-Vorstand, welcher überwiegend aus Salinenbesitzern oder deren Beamten bestand, hauptsächlich das Interesse der Saline wahrte und in Rücksicht auf die Unterhaltung des Weges die Gemeinde nicht in Unterhaltung dem Grade vertrat als solches im Verhältnis des Nutzens hätte geschehen sollen.
Die Saline zahlte zur Anlage gegen 1000 Reichstaler. Die damaligen Kohlenpreise betrugen pro Scheffel 12 Sgr und kosteten nach der Herstellung des Weges nur 11 Sgr, 10 Sgr und gingen später allmählich bis 6 Sgr und weniger herunter. Wenn nun dieses Sinken der Kohlenpreise auch nicht ausschließlich eine Folge der Wegeanlage ist, so kann man doch mit Gewißheit annehmen, daß dadurch der Scheffel um 1 Sgr billiger kommt und daß darauf die Saline bei ihrem Bedarf von jährlich 40 000 Scheffeln eben so viele Silbergroschen profitierte.
Die Gemeinde Westernkotten hat sich eines derartigen Nutzens nicht zu erfreuen. Die Grundbesitzungen in der Richtung der fraglichen Wegstrecke sind im Allgemeinen unbedeutend, indem der Weringer Schulte [=der heutige Weringhof] einen großen Theil der dortigen Feldmark besitzt und da er gewissermaßen mitten in seinen Grundstücken wohnt, meist die eigenen Wege benutzt und nur in wenigen Fällen auf einer ganz kurzen Strecke den Kommunal-Weg gebraucht; der übrige Theil der Feldflur gehört aber entweder nach Erwitte, Lippstadt oder Weckinghausen und nur einige Morgen nach Westernkotten, so daß sogar der vielbegüterte Grund- und Gutsbesitzer, Herrn von Papen, in jener Feldflur nicht ein einziges Grundstück besitzt.
Der Hauptnutzen der Gemeinde könnte etwa nur in leichtern Transport der Früchte nach Lippstadt bestehen; dieser Absatz ist aber so unbedeutend, daß es sich kaum der Rede lohnt, indem die Gemeindeglieder in Westernkotten, mit wenigen Ausnahmen, Pächter des Herrn Grafen von Landsberg und des Herrn von Papen sind, und an diese Gutsbesitzer ihre Pacht meist an Korn liefern. Dem unterzeichneten Gemeindevorstande scheint es daher in der Billigkeit zu liegen, daß die reichen Salinenbesitzer bei dem großen Vorteil, den armen Gemeindemitgliedern unter die Arme greifen, und der Gemeinde die Last der Wegeunterhaltung angemessen tragen helfen, um so mehr, als die gegenwärtige Reparatur lediglich für und im Interesse der Saline gemacht werden muß.
Der Nutzen der Saline an den Kohlefrachten beträgt bei 40 000 Scheffeln, pro Scheffel zu 1 Sgr gerechnet, 1333 Reichstaler und 10 Silbergroschen jährlich. Die Herrn Salinenbesitzer werden demnach noch einen bedeutenden Gewinn haben, wenn sie der Gemeinde zur Unterhaltung des Weges einen jährlichen Zuschuss gewähren, um deren Zahlung aus Billigkeits-Rücksichten der unterzeichnete Gemeinde-Vorstand ergebenst ersucht und worauf dann die Reparatur sofort vorgenommen werden soll.“
Wenn man sich auch noch vorstellt, daß Herr Löper gleichzeitig als Salinendeputierter und Gemeinderatsmitglied tätig war, kann man annähernd ermessen, welche Spannungen hier auszuhalten und zu bewältigen waren.
Die Salinen-Deputierten scheint das aufrüttelnde Schreiben des Gemeindevorstehers indes nicht nachhaltig bewegt zu haben. Ihre Antwort vom 30.8.1851, mit der die Akte schließt, lautet:
„Auf das gefällige Schreiben vom 28. August und betreffend die Instandsetzung des Weges von hier nach der Lippstädter Chaussee erwidern wir ergebenst, daß der Antrag um Bewilligung eines Zuschusses zu den Reparaturkosten in nächster Versammlung der Salinen-Interessenten zur Beschlussnahme vorgelegt werden soll, die Gewährung oder Nichtgewährung des Antrages kann jedoch in Bezug auf die notwendige Reparatur gleichgültig sein, da der Weg von der Gemeinde unterhalten werden muß, auch dann, wenn jener nachgereichter Zuschuß noch erfolgen sollte, weshalb wir umgehend ersuchen, die Reparatur bei der noch günstigen Jahreszeit vornehmen zu lassen.“
10.2. Salzverkauf über die Lippe
Beim Verkauf des Salzes aus Westernkotten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der Weg über die Lippe in das Ruhrgebiet und ins Rheinland eine besondere Bedeutung gespielt.
Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts verhinderten die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Anliegerstaaten entlang der Lippe deren Ausbau zur Wasserstraße. Erst der Wiener Kongreß 1815 schuf mit seiner neuen politischen Landkarte – Preußen als nun einziger Anliegerstaat unterhalb Lippstadts – die Voraussetzungen für eine Schiffbarmachung der Lippe. Unter dem agilen ersten Oberpräsidenten der preußischen Provinz Westfalen, Ludwig Freiherr von Vincke (*23.12.1774 in Minden, + 2.12.1844 in Münster) ermöglichte man zunächst eine Reihen- und Stationsfahrt, das heißt, an allen Mühlenwehren mußte die Ladung mangels Schleusen umgeladen werden. Beim Ausbau der Lippe spielte von Anfang an in den Plänen Vinckes der Salztransport von Westernkotten, Sassendorf, Werl und Unna-Königsborn eine besondere Rolle. [vgl. Strotkötter, S. 91f] Schon im Jahre 1819 konnte das System der Stationsfahrt bis Lippstadt ausgedehnt werden. Das erste Schiff traf hier, mit Steinkohlen beladen, am 21.März 1819 ein und begab sich 9 Tage später wieder mit einer Ladung Salz und einigen Passagieren auf die Rückfahrt. [vgl. Junk, 1985, S.639-641; Laumanns 1926, S. 33f; Mühlen 1980; Strotkötter 1895]
Einige Jahre später ging man an den Bau von Schleusen, um die Mühlen zu umgehen. Nach Abschluß der Arbeiten an der Schleuse Benninghausen war Lippstadt ab Oktober 1828 über diesen neuen Schiffahrtsweg erreichbar.
Der Hafen in Lippstadt [genaue Lage noch angeben] hatte sogar eine zollfreie Niederlage, also einen Freihafen-Teil.
Das Salz aus Westernkotten mußte mit schweren Fuhrwerken die etwa 6 Kilometer lange Strecke zum Lippstädter Hafen transportiert werden [vgl. oben unter 9.1.].
Über die Gütermengen, die in dieser Zeit über die Lippe flußabwärts transportiert wurden, liegen folgende Zahlen vor:
Jahr Gesamtmenge der auf der Lippe Davon Salz aus Westernkotten
transportierten Güter
1820 420 120 Zentner
1830 913 040 Zentner
1832 33 400 Zentner = 8350 Tonnen (alt) = 1670 heutige Tonnen
1840 1 643 560 Zentner
[Laumanns; Westfalens Wirtschaft vor 100 Jahren, in: Patriot vom …]
Betrachtet man die Zahlen der auf der Lippe transportierten Salzmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge des in Westernkotten produzierten Salzes, so wird deutlich, daß 1832 mehr als 90 Prozent des Westernkötter Salzes über die Lippe vermarktet wurden.
Die Lippe-Schifffahrt hatte im Jahre 1840 ihren Höhepunkt erreicht, in diesem Jahr wurden insgesamt Güter mit einem Gewicht von 1 643 560 Zentnern (= 82 300 heutige Tonnen) transportiert. Das Salz aus Westernkotten machte demnach in diesem Jahr etwas mehr als 2 Prozent des Gesamtgewichts aller auf der Lippe transportierten Güter aus.
Aus dem Jahre 1846 liegt eine Ausschreibung des Provinzial-Steuerdirektorats für den Salztransport über die Lippe vor [Wochenblatt für den Kreis Lippstadt vom 4.7.1846]
Der Salztransport von Königsborn, Werl, Sassendorf und Westernkotten sowie vom Lippstädter Hafen sollte für die Jahre 1847 und 1848 „in Entreprise gegeben werden“, Als Zielorte sind „mehre, an der Lippe, der Ruhr und dem Rheine gelegene Salzdebits-Niederlagen“ genannt.
Aus der Anzeige wird deutlich, daß die oberste Steuerbehörde federführend den Salzverkauf organisierte und durch weiträumige Ausschreibung unter Ausnutzung von Synergieeffekten möglichst günstige Konditionen erreichen wollte. Deutlich wird aber auch, daß das Salz der östlich gelegenen Salinen Rehme (später Bad Oeynhausen), Salzkotten und Salzuflen nicht zum Transport über die Lippe vorgesehen war, sondern andere Räume versorgen sollte [anders Maron 1988, S.29].
Mit dem Bau der Eisenbahnstrecken erwuchs der Lippe-Schifffahrt eine große Konkurrenz: 1847 wurde die Köln-Mindener Eisenbahn vollendet, 1850 die Bahnstrecke Hamm-Paderborn mit einem Bahnhof in Lippstadt [vgl. unter 10.3.] Der Schiffsverkehr wurde stark eingeschränkt, wenngleich 1853 noch einmal ein Versuch zur Wiederbelebung gemacht wurde. 1868 befuhr nur noch ein Schiff mit Kaufmannsgütern den Fluß und drei weitere transportierten Baumaterial. 1876 wurde die Lippe-Schifffahrt oberhalb Hamms ganz eingestellt. Neben der Konkurrenz der Bahn wird auch die mangelnde Fahrtiefe und Versandung im Bereich der Lippe-Mündung durch den Bau von Festungsanlagen bei Wesel für diesen Niedergang verantwortlich gemacht. [Junk 1985, S. 640/41; Laumanns aaO.]
Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts wiedereinsetzenden Bemühungen einer Lippe-Kanalisierung haben nur zum Bau des Lippe-Seiten-Kanals bis Hamm-Schmehausen geführt. Für das Salz aus Westernkotten hat das keine Rolle mehr gespielt. [vgl. zum Ganzen auch: Koppe, Werner, Kurze Geschichte der Schiffahrt auf der Lippe im Raum Lippstadt, in: Heimatblätter 1997, S.153-165]
10.3.Salztransport mit der Eisenbahn
Auch die Eisenbahn hat für den Transport von Salz aus Westernkotten, vor allem aber auch für die Belieferung mit Steinkohle, etwa ab 1850 eine besondere Rolle gespielt.
1825 begann Friedrich Harkort, angeregt durch die in diesem Jahre fertiggestellte erste öffentliche Dampfeisenbahn in England, als erster Deutscher auf den Bau solcher Bahnen aufmerksam zu machen. Er hielt sie nicht zu Unrecht für das geeignetste Mittel einer besseren Verbindung zwischen den altpreußischen Gebieten und dem rheinisch-westfälischen Raum, den Preußen durch den Wiener Kongreß 1815 zugesprochen worden war. Aber auch innerhalb der neuen Provinzen war unter anderem eine Verbindung zwischen dem Weserhafen Minden und Köln von großer Bedeutung. [nach Junk, Heinz-K., Stadt und Stadtraum im 19.und 20. Jahrhundert; in: Lippstadt. Beiträge zur Stadtgeschichte, Lippstadt 1987, S. 611-667, hier S.643]
Vor allem über die Streckenführung zwischen Dortmund und Minden wurde lange verhandelt. Schon früh war auch die Saline Westernkotten in diese Fragestellung eingebunden.
Die entsprechende Akte im Depositum der Saline Westernkotten [Nr.48] beginnt mit einem Schreiben des Werler Freiherrn von Lilien-Berg an den Freiherrn von Landsberg-Velen vom 16.3.1833. Darin weist er darauf hin, daß die Salinen am Hellweg ein besonderes Interesse an der zukünftigen Linienführung dieser Bahn haben sollten. So führt er unter anderem aus: „Bekanntlich wird der größte Theil der Rheinprovinz mit Salz aus dem Auslande versorgt. Den größeren Theil dieses Bedarfs …beabsichtigt der Bergwerks-Fiskus durch die Königliche Saline Neusalzwerk bei Rheme [heute Bad Oyenhausen] an der Weser zu versorgen und zur Produktion derselben die Steinkohlen aus der Grafschaft Mark dahin zu schaffen. Beides würde durch die Eisenbahn erreichbar sein und den Preis einer Tonne Salz zu 408 Pfund bis Cöln am Rhein mit Emballage (?) und Transport zu 4 Reichstaler 5 ½ Silbergroschen gestalten. Da bei den durch die Natur der besagten Saline verliehenen Hülsmitteln nicht abzusehen ist, wie weit die Produktion vermehrt werden könnte, da man daselbst noch immer zur Auffindung reicherer Soolen mit Bohrversuchen beschäftigt ist, so würde eine Eisenbahn, welche bloß dieser Saline Kohlen zu- und Salz abführte, in dem Maße den Privatsalinen am Hellwege Salzkotten, Westernkotten, Sassendorf und Werl verderblich werden.“
Unter anderem durch die Bildung eines Hellweg-Komités, zu dessen späteren Ausschuss-Vertreter neben den Herren von Lilien-Berg, von Bockum-Dolffs und Opderbeck aud der Westernkötter Salzfaktor Brune gehörte [vgl. den weiteren Schriftverkehr in der Akte 48] konnte unter anderem erreicht werden, daß ein Streckenverlauf durch den Hellwegraum offiziell in Angriff genommen werden sollte. Denn so heißt es in der „Denkschrift zur Begründung des Projects der Eisenbahn-Anlage zur Verbindung des Rheins und der Weser“, die am 18. Juni 1836 von den Initiatoren, einem Komité in Minden, formuliert und gedruckt wurde [ebd. S. 6]:“Die von den Technikern ausgewählte Linie beginnt dicht über Minden am linken Weserufer und geht bei Neusalzwerk, Herford, Bielefeld, Gütersloh, Lippstadt, Sassendorf, Soest, Werl, Unna, Dortmund, Witten, Hagen, Schwelm, Barmen und Elberfeld vorbei, bis Hammerstein an der Wupper. Für diese 29 ¾ Meilen lange Strecke sind alle Stimmen über die Richtung einig.“
Geplant war, die 3,8 Millionen Taler teure Bahn mit 19 000 Aktien zu je 200 Talern zu finanzieren, für die man nun Zeichnungswillige suchen mußte.
In der genannten Denkschrift wird vor allem der Nachweis zu führen gesucht, daß das Anlage-Kapital gesichert und gewinnbringend ist. So verweisen die Verfasser auch darauf, daß eine neue Eisenbahnverbindung auch neue wirtschaftliche Aktivitäten nach sich zieht. In diesem Zusammenhang wird auch Westernkotten genannt [S.25/26]:
„Die Salinen Werl. Höppe, Sassendorf, Westernkotten und Salzkotten schaffen nach und nach die Holzfeuerung ab und werden dann zur Siedung der bisher gewonnenen Salzmenge 49 000 Centner Kohlen mehr verbrauchen, nämlich:
Werl und Höppe 9 000 Zentner
Sassendorf 9 000 „
Westernkotten 10 000 „
Salzkotten 21 000 „
Diese Kohlen bleiben für die beiden ersten Salinen 5 Meilen und für die 3 letzten 7 Meilen auf der Bahn und betragen demnach 325 000 Zentner für eine Meile.
Künftig sollen in Werl, Höppe, Sassendorf und Westernkotten zusammen 36 200 Centner Salz mehr gesotten werden, wie bisher, bestimmt für die Rheinprovinz. Die Bahn wird 12,5 und 14,5 Meilen zu benutzen sein und für eine Meile 481 300 Zentner Verkehrsmasse gewinnen.
Zu diesen 36 200 Centnern Salz gehören andere 21 000 Zentner Kohlen, welche (für eine Meile) 123 800 Zentner Eisenbahngut bilden.“
Obwohl auch Fürst Leopold II. von Lippe dem Projekt positiv gegenüberstand, kam das Unternehmen nicht zustande. Es stellte sich heraus, daß sich die private Gesellschaft für die Rhein-Weser-Bahn mit dem Projekt überfordert hatte. 1841 wurde die Gesellschaft liquidiert. [Junk aaO. S.643]
Auch die Salinen-Interessenten haben damals keine Aktien gezeichnet. Der von Papen’sche Rentmeister Franz Erdmann war darüber nicht sehr glücklich. So schreibt er am 4.9.1836 an den Salzfaktor Brune: „Lieber Brune! Frau von Papen hat sich nicht erklärt, wieviel Actien sie nehmen will; aus Ihrem Schreiben scheint mir hervor zu gehen, daß ich den Beschlüssen des Collegs in dieser Beziehung beitreten soll. Warum aber die Interessentschaft keine Actien unterzeichnen will, begreife ich nicht. – Früher wurde es ja zugesagt. Was Herr von Landsberg thut, wird nach Verhältnis Frau von Papen auch thun. Gruß Erdmann.“
Noch am gleichen Tag schreibt Brune an von Landsberg in Münster, ob er nicht doch Aktien zeichnen wolle, erhält aber dann mit Schreiben vom 11.9.1836 nur zur Antwort, daß dieser nicht als Salinen-Interessent, wohl aber „privatim“ 20 Aktien gezeichnet habe.-
Im Mai 1845 fiel die Entscheidung für eine neue Trasse, diesmal aber weiter weg von Westernkotten und Lippstadt. [Junk aaO S.644] Gleichzeitig wurde aber versichert, eine Verbindungslinie nach Kassel über Lippstadt und Paderborn ebenfalls in Angriff zu nehmen.
1847 war die Gesamtstrecke der Rhein-Weser-Bahn über Hamm fertiggestellt; aber die Gesellschaft für die Bahn nach Kassel, die „Köln-Mindener-Thüringer Verbindungsbahn“, deren Strecke über Lippstadt und Paderborn gehen sollte, geriet in Schwierigkeiten, die ein Jahr später zur Übernahme des Unternehmens durch den preußischen Staat führten.
Jetzt baute die „Königliche Direktion der Westfälischen Eisenbahn“ die Strecke. Bereits 1850 war das Teilstück von Hamm nach Paderborn fertiggestellt. Lippstadt und damit auch die Westernkötter Saline hatte einen Bahnanschluß.
Am 21.6.1853 wurde auch die Reststrecke von Paderborn bis Warburg eröffnet, und der preußische König befuhr persönlich die Strecke.
Auch die „verehrliche Salinen-Interessentschaft zu Westernkotten“ ist unter dem 18.11.1851 in dieser Angelegenheit nochmals angeschrieben worden, und zwar vom Komité für die „Dortmund-Soester-Bahn“. Interessant in diesem Schreiben sind die Ausführungen zu den Steinkohlepreisen:
„Zu den besonders Interessierten gehören auch Sie. Erlauben Sie uns, nur einen Punkt hervorzuheben.
Sie zahlen jetzt für den Transport der Steinkohlen:
- von der Zeche bis Dortmund 7 Pfennig
- von Dortmund bis Hamm 1 Sgr
- von Hamm bis Soest 7 Pfennig
Summa 2 Sgr 2 Pfennig
pro Zentner bis Soest.
Nach Fertigstellung der Hellwegbahn können Sie Ihre Kohlen von den östlich Dortmund belegenen nicht über 5 Meilen von Soest entfernten Gruben beziehen. Sie zahlen dann für 5 Meilen Entfernung 11 Pfennig pro Zentner, gewinnen also 1 Sgr 3 Pfg pro Zentner. Sie produzieren jährlich rund 900 Last Salz. Dazu bedürfen Sie … 31 500 Zentner Kohlen. Nimmt man die Transport-Ersparnis zu nur 1 Sgr pro Zentner an, so gewinnen Sie jährlich über 1000 Reichstaler.“
Aber all diese Argumente und auch ein Hinweis darauf, daß das Sälzerkolleg in Sassendorf bereits Aktien im Wert von 10 000 Talern gezeichnet habe, kann das Westernkötter Sälzerkolleg nicht umstimmen: Alle erklären am 15.10.1851, daß sie keine Aktien zeichnen werden.
Zu diesem Zeitpunkt war das Teilstück im Raum Lippstadt bereits fertig, und so hat das Sälzerkolleg wahrscheinlich keine Notwendigkeit gesehen, in ein Reststück, das nicht unmittelbar vor der Tür lag, zu investieren. Mit dieser Absage endet die Akte 48.
Wie stark die Bahn für den Transport von Steinkohlen und Salz in den Jahren ab 1850 von der Saline genutzt wurde, ist bisher nicht bekannt. Da aber die kanalisierte Lippe zu dieser Zeit schon fast wieder bedeutungslos geworden war und die Chausseen keine echte Konkurrenz darstellten, ist davon auszugehen, daß über die Bahn ein ganz großer Teil des gesamten Salzes der Saline Westernkotten zu den Niederlagen und zum Verbraucher befördert wurde.
Noch intensiver wurde die Nutzung der Bahn ab 1883, als die Bahnlinie Warstein-Lippstadt fertiggestellt wurde.
11. Das Ende des Salzmonopols 1867
„Mit dem Beginn des staatlich initiierten Salzbergbaus begann in Preußen dann der Niedergang der alten westfälischen Salz-Siederei. Von besonderer Bedeutung war die Entdeckung der Steinsalzlager zu Staßfurt im sächsischen Kreis Kalbe…Nachdem am 3. April 1839 mit der Bohrung begonnen wurde, zeigte sich im Juni des Jahres 1843 bei 816 Fuß Tiefe das erste Salz; bis 1851 waren 1851 Fuß Tiefe erreicht, doch nicht das Ende der Lagerstätte. Nachdem zuerst Zweifel über die Nutzung auftraten, da man zunächst die große landwirtschaftliche Bedeutung des Kalianteils in den abfällig Abraum-Salz genannten Schichten nicht erkannte, stieß man bei etwa 1000 Fuß auf reines Kochsalz, dessen Förderung alsbald aufgenommen wurde. Schon die vermutete Ausdehnung des Salzstockes von etwa 20 Quadratmeilen erschloß somit ein kaum erschöpfbares Salzreservoir, das nun das jahrtausendelang begehrte weiße Gold zu einem billigen Massenartikel werden ließ…Mit fast 80 000 t lag die Produktion dieses einzigen Werkes 1865 schon viermal so hoch wie die Siedemenge ganz Westfalens, von der in Unna-Königsborn etwa die Hälfte gewonnen wurde.“ [Burgholz 1988, S.286]
[Abb. S. 266, ergänzt um 80 000 t aus Staßfurt, einfügen]
Der preußische Staat zog daraus seine Konsequenzen. Die wichtigste Änderung erfuhr der Salzhandel in Preußen durch das Gesetz vom 9.August 1867, das die Einführung einer Salzabgabe vorsah und das Salzmonopol aufhob. Damit legte Preußen den Salzhandel wieder in die Hände des Sälzer-Kollegiums zurück. Die Landesregierung verlangte nun von jedem Zentner Salz eine Abgabe von maximal 2 Thalern, die die Produzenten des inländischen Salzes, also auch die Westernkötter Sälzer, oder die Einführer ausländischen Salzes an den Staat abzuführen hatten. Der Viehsalzverkauf blieb abgabenfrei. [vgl. Piasecki 1991, S.162/163] Die fiskalischen Salinen, in Westernkotten der fiskalische Salinenanteile, der 1/15 der Produktionsanteile ausgemacht hatte, wurden an die Privatwirtschaft, in Westernkotten an die gesamte Pfännerschaft zur gemeinschaftlichen Nutzung, verkauft.
Quellen und Literatur:
- Amtsblatt Arnsberg 1816, S.61-64
- Depositum der Sälzer der Saline Westernkotten im Staatsarchiv Münster
- Köhler, Ignatz, Beschreibung der Saline Westernkotten, S. 45/46
- Marcus, Wolfgang, Salzfaktoren in Westernkotten; in: Aus Kuotten düt un dat Nr. 46, 1992
- Piasecki 1991, S. 161/162
- Steimann, Rudolf, Zur Geschichte der Familie Bredenoll-Steimann-Hille, a.a.O. S.31
- Stockmann S. 139/140
- Walter, Manuskript eines Vortrages in Salzkotten 1997, S. 10
- Westheider 1994