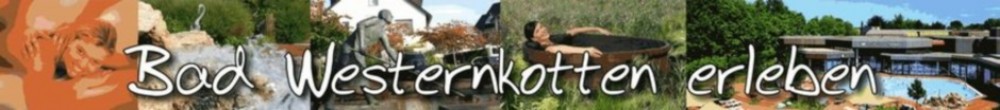Von Wolfgang Marcus
Beim Aufräumen meiner Unterlagen fand ich unter anderem einen Aufsatz in den Geseker Heimatblättern von Dr. Wolfgang Maron vom Februar 1988. Er leitet den Text mit folgenden Sätzen ein: „Wie für die meisten geistlichen Territorien, so besitzen wir auch für das kurkölnische Herzogtum Westfalen aus der Zeit vor 1800 nur wenige wirtschaftsgeschichtlich verwertbare Materialien. Anders als etwa in den preußischen Gebieten, wo der Staat als aktiver Förderer der Wirtschaft auftrat, war hier das staatliche Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung nur gering, eine staatliche Statistik kaum vorhanden. Erst mit der Wende zum 19. Jahrhundert und in mehrfachen territorialen Veränderungen ändert sich das Bild. Neben der nun auch hier einsetzenden amtlichen Statistik liegen aus diesen Jahren einige Landesbeschreibungen vor, die sich um eine anschauliche Schilderung der Zustände bemühen. – Das wohl bekannteste Werk aus dieser Zeit ist die Reisebeschreibung Westfalens von Justus Gruner (1802/1803)[1] findet für die Darstellung des Herzogtums indessen nur düstere Farben. Im Mittelpunkt seiner Kritik steht der zurückgebliebene Zustand der Wirtschaft, den Gruner in erster Linie auf die mangelhafte Verwaltung und die geistliche Landesherrschaft zurückführt. Die Quellen des Landes würden kaum genutzt; Industrie sei den Bewohnern daher so der Autor ‚eine gänzlich unbekannte Sache, Ignoranz und Insolvenz‘ (etwa Dummheit und Gleichgültigkeit) machten vielmehr die vorherrschenden Charaktereigenschaften der hier lebenden Menschen aus.“
Dieses Buch wurde später bearbeitet und ergänzt, und zwar von Gerd Dethlefs und Jürgen Kloosterhuis. Erschienen ist das Buch im Jahr 2009 im Bohlau-Verlag.[2]
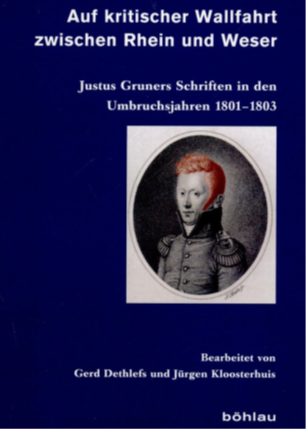
Hier ein Bild von Justus Gruner (Quelle: Wikipedia):

Mich interessierte natürlich die Frage, ob auch Westernkotten in diesem Buch vorkommt? – Leider nicht, wahrscheinlich auch, weil die Kölner Erzbischöfe als Landesherren wenig Interesse an der wirtschaftlichen Weiterentwicklung hatten und das Salz in Westernkotten ja dem Paderborner Bischof als Obereigentümer gehörte. Die vom Salzkottener Pfarrer Philipp Korte[3] angestoßene technische Weiterentwicklung erfolgte deutlicher in preußischer Zeit.
Digital ist dieses Buch in einigen Abschnitten zu lesen. Im Inhaltsverzeichnis wird folgende Gliederung aufgeführt:
- Skizze des jetzigen Zustandes des geistlichen Westphalens und einiger Verbesserungsvorschlage zur höheren sittlichen und einträglicheren bürgerlichen Kultur desselben
- Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung oder Schilderung des sittlichen und bürgerlichen Zustandes Westphalens am Ende des achtzehnten Jahrhunderts
- Reaktionen auf Gruners ,,Wallfahrt“ im Westfälischen Anzeiger.
Es folgen nun einige Passagen, die sich nur teilweise auf die Stichworte „Salz“ und „Salinen“ beziehen.[4]
Unna
Zu Unna schreibt Gruner: Nicht wegen seiner romantischen Abwechselungen, (welche mit dem Sauerlande aufhören), aber wegen seiner reichen Fruchtbarkeit, und der Wohlhabenheit seiner häufigen Dörfer, ist der durch eine gesegnete Ebene hinlaufende, zwischen Dörfern, Wiesen und Kornfeldern abwechselnde Weg von Dortmund nach Unna äußerst angenehm, und, wie er, der ganze nördliche Theil der Grafschaft Mark, welcher einen trefflichen Kleiboden und fleißige Landleute hat, die das Geschenk der Natur zu verdienen und zu veredeln wissen. Ackerbau ist daher auch hier eben derselbe ausschließliche Nahrungszweig, wie im Sauer- oder Süderlande [Der Name Sauerland, womit man den südlichen Theil der Grafschaft Mark und das Herzogtum Westphalen zu bezeichnen pflegt, ist in Hinsicht seines Ursprunges sehr ungewiss. Manche leiten ihn daher ab, weil seine Bereisung, Manche aber, weil seine Bearbeitung (der Gebirge und des kälteren Klimas wegen) sehr sauer sey; die Meisten erklären sich jedoch den Namen aus der Lage, und sagen daher wohl mit dem meisten Rechte: ‚Süderland‘] das Fabrikwesen.
Auch Unna, eine der ersten Städte der Grafschaft, lebt bloß von der Feldwirtschaft, dem daraus entstehenden Fruchtverkaufe an seine südlichen Nachbarn, und vom Bierbrauen und Brandwein-Brennen. – Die Einwohner sind wohlhabend; aber das Äußere der Stadt gleicht auch einer bloßen Landstadt. – Häuser und Gassen sind schlecht, und von Polizeieinrichtungen habe ich Nichts gefunden; wahrscheinlich bekümmert sich das hiesige Landgericht bloß um die Justiz. Indes gibt es hier viel Leben, vorzüglich in geselliger Hinsicht, welches von der nur eine Viertelstunde entfernten Saline zu Königsborn herrührt. Diese, welche sehr reichhaltige Quellen hat, und jährlich eine ansehnliche Menge Salz produziert, womit Kleve, Geldern, Berg, Münster, u.s. w. versehen werden, setzt eine Menge von Menschen in Nahrung, und verschafft dadurch dem benachbarten Unna viel Durchfuhr, Verkehr und Leben. Sie hat sechs oder acht Gradierhäuser, durch die sie ihre Sole bis zu 9 Loth veredelt, und gegenwärtig wird der eine ihrer beiden Brunnen durch eine Dampfmaschine (nach dem Muster der Waltschen [!]) getrieben™, welche zwar 30.000 Thaler gekostet haben, und jährlich 6.000 Thaler Unterhalt kosten, aber auch mehr leisten soll, als sonst 137 Pferde getan haben, und mit Kohlen erhalten wird, welche die Grafschaft selbst in hinreichender Menge hervorbringt. Die Einkünfte dieser königlichen Saline sind sehr bedeutend. – Die bei derselben angestellten Offizianten, die Beamten des Landgerichts in Unna, ein paar Ärzte, gebildete Kaufleute, und ein hier wohnender Landsyndikus Mark, ein vorzüglich gastfreier, jovialischer Mann, bilden einen geselligen Zirkel, in dem jeder Fremde offenen Zutritt findet, und auf das gefälligste behandelt wird. Sie halten einen Klub, an dem beide Geschlechter Theil nehmen, und womit zuweilen ein Ball verbunden ist, den Fröhlichkeit und Einigkeit beleben, Ich wohnte einem solchen bei, und fand auch hier das Sprichwort: Wer gern tanzt, dem ist leicht aufgespielt!“ bestätigt: denn das ganze Orchester bestand aus zweien (elenden) Violinen und einem (ebenso elenden) Bass, und dennoch tanzte die ganze hiesige schöne und lustige Welt dazu bis spät Mitternachts. Nur ein Souper unterbrach die Tanzbegier, die aber nicht so schnell zu sittigen war, als die Esslust, welche man bald stillte, um sich wieder zum Tanz und zur Flasche zu begeben, die – nach dem verschiedenen Alter – in gleichem Ansehen zu stehen scheinen. Dass bei einer solchen Tendenz zur Lustigkeit manchmal über die Schnur gehauen wird, und dass überhaupt der Ton dieser Geselligkeit vielleicht zu ungezwungen sein mag, das getraue ich mir eher zu behaupten, als zu verneinen, obwohl ich selbst von keiner Unsittlichkeit Zeuge gewesen bin, und die Eltern der jungen Leute mir zurufen werden: Wir sind ja dabei gewesen! — Nun! nun! ich nehme es nicht so genau, sondern lade Jeden, der jovialischen Ton, volle Flaschen, muntre tanzlustige Mädchen, und eine unbegrenzte freundliche Gastfreiheit liebt, ein, nach Unna zu gehen. Er wird gewiss dort seine Rechnung finden.
- Die Entzündung. Kur.
Es ist nichts leichter, als selbst im Fuß gehen auf einem ebenen Wege, an warmen Tagen, einzuschlummern und im Schlafe fortzugehen. Mir ist das oft begegnet, wenn ich in Westphalen und Niedersachsen durch die Haiden ging. Öfter aber noch und leichter war es mir da, wo nicht die Abwechselung der äußeren Gegenstände meine Phantasie lebhaft beschäftigte, diese in so tiefe Träumereien einzuwiegen, dass ich alle Umgebungen vergaß, bis ich gewaltsam aus meinem Seelenschlafe geweckt ward. So ging es mir beim Eintritt in Unna. Ich war auf dem ebenen Wege, durch die Wärme des Tages und die Einförmigkeit der Gegend, in Phantasieunterhaltungen versunken, aus denen mich erst das lebhafte Getümmel auf der Gasse in Unna (wo gerade Jahrmarkt war) zu wecken vermochte. Ungern riss ich mich los, blickte auf, und – fuhr unwillkürlich zusammen, denn mir gegenüber stand an einem Fenster ein Mädchenkopf, der meinen Traum zur Wirklichkeit machen zu wollen schien. Schöner könne ihn Rubens nicht mahlen, sagte die trunkene Phantasie; und wie entsprechen seine Züge meiner innersten teuersten Erinnerung, flüsterte das Herz. Ach, es war so, wirklich so; die Ähnlichkeit war täuschend, aber nur ein künstliches Spiel der Natur, das schwache Herz in Versuchung zu führen. – Und wie könnte das, unterstützt von der Phantasie, widerstehen? Ich blieb unwillkürlich stehen – ich verwandte kein Auge von dem Fenster – ich freute mich, als ich sah, dass man auch mich bemerkte – ich ging diesen wirklich schönen Platz – unermüdlich auf und nieder, bis die Erscheinung verschwand, und mich dann die Notwendigkeit ins Wirtshaus trieb. Leider war keins in der Nähe dieses Schönheitstempels, aber mit Freude ergriff ich das Anerbieten, den Ball zu besuchen. Ich hatte mich nicht geirrt — die Schöne war dort; doch meine Gluth kühlte sich allmählich ab. Die Ähnlichkeit war da, sie blieb — im Äußern, in der Form; aber, ich bekenne offen, der Ton dieses lustigen Balles entsprach meinen Gefühlen nicht – und je öfter, je rauschender ich meine Göttin vor mir herumwalzen sah, um so irdischer erschien sie mir. Meine warmen Empfindungen wurden bitter, und ich war froh, als die Täuschung verschwand; nur wenige Sehnsucht blieb nach dem so reizend geschienenen Bilde zurück.
Mit dieser unmutigen Erinnerung beschäftigt, wandelte ich am dritten Morgen die Straße von Unna nach Werl hinaus, ebenso in Träumereien versenkt, als ich beim Hineinkommen gewesen war. Ja, es ist vorbei mit diesem Geschlechte! rief ich zuletzt erbittert aus – es ist überall entartet; Gefallsucht ist sein Götze, und ein reines Herz such’ ich vergebens. ,Ach Gott, ach Gott‘ rief in diesem Augenblicke eine klägliche Weiberstimme neben mir, und ich stolperte zugleich über Etwas hin, das mich beinahe zum Fallen gebracht hätte. Was gibt’s denn? rief ich, bestürzt mich umsehend, und erblicke ein junges Bauernmädchen, das die Scherben einiger zerbrochenen Töpfe aufsammelte. „Sie sind da über meine Milchtopfe gefallen,” schluchzte sie, „und haben sie zerbrochen.“
Ja! ihr lasst uns fallen – daran seid ihr selbst schuld, erwiderte ich in innerer Beziehung auf den mich beschäftigenden Gegenstand.
„Ach!“ (Sie blickte mich aus den schwimmenden blauen Augen mit heller Freundlichkeit an) Ich bin gewiss nicht schuld daran. Sie kamen so wild daher: warum haben Sie doch nicht vor sich hingesehen?“
„Du hast Recht; ich will dir den Schaden bezahlen. Hätte ich vor mich gesehen, ich wäre niemals betrogen worden. Was kosten deine Töpfe? „Das kommt auf Sie selbst an, lieber Herr! Ich will Sie gewiss nicht betrügen.”
„Du scheinst ehrlich — aber sie scheinen Alle so. Hier nimm!“ – „Lieber Herr, das ist zu viel! Sie sind so wunderlich – so gut, und doch so böse. Ach, ich habe ihnen ja nichts Böses getan — ich werde noch Scheltens genug zu Hause bekommen um ihretwillen.” – Gutes Mädchen! nicht du, Andere –
„Ach, ich bin auch zu arm und zu schwach. Ein Mädchen kann ja nur bitten, und es tut Ihnen gewiss keine etwas Leides, wenn Sie nicht selbst wollen. – Du hast Recht, sagte ich, und gab ihr noch Etwas; ich danke dir, und will dir auch das Schelten zu Hause vergüten.
„Ach nein! Wenn Sie nur freundlich aussehen, so bin ich ganz zufrieden. Ich kann Niemand böse sehen, so fällt mir mein Christel ein, wenn der böse ist, und das tut mir weh; dann gibt er mir die Schuld, ich sey zu freundlich, oder zu finster, und ich bin doch nie schuld daran. Ach, meine Mutter hat wohl Recht: wir sind der unschuldigste Theil, und doch müssen wir immer leiden!”
Ja, sie mag Recht haben! — rief ich, und ergriff des Mädchens Hand. Du hast mich kuriert – ich wäre dir mehr schuldig, aber nimm das, und erkaufe dir von deinem Christel eine gute Stunde dafür.
„Für meinen Christel? Ja, da nehme ich es mit tausend Dank; er soll auch oft an Sie denken, und ihre Liebsten in der Stadt bitten, dass Sie nicht mehr so böse werden, wie heute.”
Sie verließ mich mit fröhlichem Kopfnicken, und ich setzte meinen schönen Weg nach Hamm ohne Träumereien fort.
- Torvisitation. Hamm
„Wo kommt Er her, Landsmann?“ rief mir beim Eintritt in Hamm einer der beiden wachthabenden Soldaten entgegen. Von Unna. „Ist Er da zu Hause?“ – Nein! „Na, wo denn her?“ – Aus Osnabrück. „So, so! Na, hat Er auch ’nen Pass?“ – O ja! „So komm Er her.” – Er führte mich an die Wache: „Unteroffizier!“ Dieser kam heraus: „Hier ist so ein fremder Musje [?]!“ – „Hat Er einen Pass?“ fragte dieser mit gedämpfter Stimme.
[Die beiden nächsten Seiten sind digital nicht abrufbar.]
- Werl
…gen auf der Gesellschaft, bis ich einen Brief an eine dortige adelige [S.392] Dame hervorzog, der Tochter des Hauses gab, und mich nach dem Befinden, dem Aufenthalt und der Wohnung dieser Edelfrau erkundigte. Nun bekam man Muth, Vertrauen und Geselligkeit; ich öffnete mich dann auch, und man gestand mir, dass man mir anfangs nicht getrauet hätte, weil schon mehrere Fußreisende die Wirtin um die Zeche geprellt hatten. Dagegen war denn freilich Nichts einzuwenden, als das Erbieten zur Pränumeration, welches aber nicht angenommen ward, weil die alte Mutter nicht zugegen war, und die Jugend immer einem ehrlich scheinenden Worte leichter traut, auch in diesem Hause besonders gutmütig und zuvorkommend war.
An Werl fand ich eine alte sehr hässliche Stadt, deren alte Häuser und über alle Beschreibung elende Gassen den Wohlstand nicht vermuten ließen, der hier wirklich herrscht. Dieser rührt teils von dem guten Ackerbau des sie umgebenden wohl bebauten und sehr fruchtbaren Bodens, und dessen schnellen Absatz in die raueren Gebirgsgegenden, her; — teils geht die Straße der Kaufmanns wegen von [S.393] Wesel nach Braunschweig durch diesen Ort, obwohl sie jetzt, wegen der angrenzenden schlechten Wege und des scheußlichen Stadtpflasters, ziemlich verlassen wird, und die Einwohner nicht vermögen, in dieser Hinsicht eine Verbesserung zu bewirken. Dieser setzt sich vorzüglich der Neid und die Eifersucht der benachbarten Arnsberger entgegen, welche vor Zwölf Jahren selbst die schon regulierte Anlegung einer Chaussee durch Werl zu hintertreiben wussten. Einen dritten bedeutenden Nahrungszweig gewährt das hiesige Kapuzinerkloster durch das hier befindliche wohltätige Marienbild, zu welchem immerwährend eine große Menge von Wallfahrten, und zwar (mirabile dictu) vorzüglich aus den protestantischen Orten der Grafschaft Mark, namentlich aus der Soester Börde, stattfinden sollen.
Dicht neben der Stadt liegt eine Saline, welche 6 adeligen Familien, nämlich vier Familien von Lilien, einer von Mellin und von Pape, gehört. Jedes männliche Glied dieser Familien genießt einen bestimmten Theil der Revenuen gleich von der Geburt an, und dieser Antheil steigt mit den zunehmenden Jahren. Der Ertrag des Salzwerkes ist bedeutend, aber die vielfache Zerteilung macht die einzelnen Revenuen klein; das weibliche Geschlecht partizipiert nicht daran. –
Die Glieder dieser adeligen Familien, die Beamten der hiesigen Gerichte, einige wohlhabende Kaufleute und mehrere Familien aus der Nachbarschaft, bilden den hiesigen geselligen Zirkel. Die Mannspersonen versammeln sich abends gewöhnlich auf einem eben nicht brillanten Billard, wo das Bedürfnis der Geselligkeit unter den Edelleuten und den Bürgern eine seltene Annäherung und Gemeinschaft hervorbringt, die Unterhaltung aber natürlich umso verschiedenartiger ist, als Werl in Hinsicht der Aufklärung sich nicht sehr rühmlich auszeichnet. Indes gibt es hier und da einige helle Köpfe, und ich fand an dem Freiherrn Leopold von Lilien und seiner trefflichen Gattin eine Edelfamilie im wahrhaften Sinne des Wortes; Bildung….
- Soest, Bad Sassendorf
[ab Seite 397]
…Das Gebiet der Stadt ist ansehnlich, und ihre Börde zählt zehn sehr wohlhabende Kirchdörfer, unter denen sich Sassendorf, wegen seiner Saline, vorzüglich auszeichnet. Diese Börde, nebst dem Gebiet der Stadt selbst, steht noch jetzt unter dem städtischen Magistrat, als erster Instanz in Polizei-, Kriminal- und Kirchen-Sachen, und die sogenannten zwölf Statute sichern gesetzlich die Gerechtsame desselben und die Privilegien der Bürgerschaft. Außerdem ist aber in Zivilsachen das königliche Großgericht selbst für die Bürger die kompetente Instanz, und Appellationen gehen an die [Kleve-]Märkische Regierung, von dort aber nach Berlin.
Das Interessanteste, was Soest aufzeigt, ist das dortige städtische Archiv, in dem man eine Menge interessanter Urkunden und Dokumente findet; nur ist es Schade, dass man seinen Gebrauch dem Fremden nicht durch ein zweckmäßiges Sachregister erleichtert, und es in chronologische Ordnung bringt. Das Rathaus ist ein altes gotisches Gebäude der schlechteren Art, und beherbergt in seinen unteren Theilen und Nebengebäuden sehr schlechte Kriminalgefängnisse. Dagegen darf man nicht vergessen, das Haus Kaiser Carls des Großen zu sehen, welches man hier mit stolzer Zufriedenheit zeigt.
Soest ist im Innern von weitem Umfange. Die Stadt ist meist protestantisch, der Dom aber katholisch. Die Kanonici dieses Domstiftes, ein adeliges Fräuleinstift, mehrere hier wohnende Edelleute, die königlichen und städtischen Räte und Beamten, können einen ansehnlichen geselligen Zirkel bilden. – Auch soll es zwar nicht an Vergnügungen, Bällen, Konzerten, u. a. fehlen, aber die z6gernde Amalgamation der verschiedenen Stände manche Freude kälter, und die Traulichkeit lockerer machen. Im Herrmannschen Hause fand ich einen wöchentlichen Club von bürgerlichen Mannspersonen, in dem gespielt und geplaudert wird. Ich fand mehrere gebildete Köpfe darin, und lernte vorzüglich an dem Domscholaster Kruse und an dem Justiz-Kommissar Cappel ein paar talentvolle und kenntnisreiche Männer kennen, nach deren Versicherung es überhaupt in Soest nicht an literarischer Kultur fehlt.
Übrigens hat Soest, ohne nähere Bekanntschaft mit interessanten Individuen, für den Fremden nicht viel Anziehendes, und auch ich konnte nicht länger dort verweilen, als nötig war, mich mit ihm bekannt zu machen. Seine Lage ist fruchtbar, aber nicht romantisch. Die Zusammensetzung seiner Verwaltung zeigt sich deutlich im Innern, und von der Polizei habe ich wenig Ruhmwürdiges gesehen; wenigstens war das Betteln nicht verboten, und eine Gassenordnung noch nicht eingeführt.
- Lippstadt und Umgebung
Es war gegen 10 Uhr, als ich Soest verlief, um nach Lippstadt zu gehen. Die Sonne stand am unbewölkten Horizont, und schickte feurige Strahlen auf mich herab. Der Weg ist eben, wird allmählig sandig, und ich hatte daher die Last der Hitze über und unter mir zu ertragen. Mit jeder Viertelstunde schlich ich matter und müder einher – meine Fußsohlen brannten, mein Mund lechzte nach Erfrischung – doch wollte ich, um Lippstadt noch mittags zu erreichen, und aus Furcht vor jedem Trinken, nirgends einkehren, und würde so fortgeschlichen sein, wenn nicht zuletzt ein rührendes Schauspiel mich unwiderstehlich an sich gezogen, und meinem starren Vorsatze durch sanftere Empfindungen abtrünnig gemacht hätte.
Nicht fern vom Wege erblickte ich nämlich die schönste Gruppe inniger Liebe, zarter Sorgsamkeit, und biederer, herzlicher Einfalt. Unter einem Baume, dessen Schatten in der Mittagshitze zwiefache Kühlung gewährte, ruhte, teils an ihn, teils auf die Schulter eines jungen blühenden Weibes gelehnt, ein junger Bauer, dessen träumendes Gesicht und ermattete Stellung (neben den nicht weit von ihm entfernten Arbeitsinstrumenten) deutlich genug bewiesen, dass er sein Brod im Schweiße seines Angesichts erwarb. Das junge freundliche Weib trocknete ihm wechselweise die Stirne, umarmte und küsste ihn, reichte ihm aus einem nebenstehenden Topfe zu essen, und bog sich dann wieder sorgsam zu dem Säugling herab, der in stiller Ruhe auf ihrem Schoß ruhte. — Wechselweise liebkoste der glückliche Gatte und Vater Weib und Kind. – Das Ganze war die rührendste, schönste Szene der Natur, und ich stand {ohne an die so oft verschrieene und zum Überdruss besungene ,Liebe unterm Halmdache‘ zu denken) lange, von der Wahrheit, Einfalt und Herzlichkeit dieser natürlichen und doch mir ganz seltenen Szene gefesselt, da, bis ich von dem nur in sich lebenden glücklichen Paare bemerkt ward. Die zuweilen stolze und froh aufschauende Frau erblickte mich zuletzt; man winkte mir – ich trat näher, und bat um einen Trunk, den ich bereitwillig erhielt, und mich zu dem einigen Paare niedersetzte, das sich auch durch mich nicht stören ließ. Hier erfuhr ich denn auch ihre Geschichte. Der junge Mann hatte als Knecht dem Vater seiner Frau, einem reichen Bauern, gedient. Durch diese Bekanntschaft entspann sich eine Liebe zwischen beiden jungen Leuten, die täglich zunahm, ohne dass der unwillige Vater sie unterdrücken konnte. Eine Heirat wollte er indes, bei der Armut des jungen Menschen, schlechterdings nicht zugeben, und entfernte ihn aus dem Hause. Allein der Liebhaber blieb im Orte, und heimlich hielten die jungen Leute öfters Zusammenkünfte. Der Vater ward…
[Seite 399-401 fehlen bei der digitalen Version.]
…Für die öffentliche Bildung geschieht wenig. Das hiesige Gymnasium hat seit 1788 ein geräumiges schönes Schulgebäude, mit großen, hellen, gesunden Klassenzimmern, einen großen Saal, ein Bibliothekzimmer, auch eine kleine Bibliothek, aber keinen Fond zur Erweiterung derselben, und die Lehrer einen so kärglichen Gehalt, dass sie häufig einen auswärtigen Ruf annehmen, und daraus ein öfterer [häufigerer] schädlicher Wechsel derselben entsteht. –
Übrigens ist die Einrichtung zweckmäßig, die Klassenordnung aufgehoben, und ein Wechselunterricht eingeführt. – Allein eben dies gefällt denen steif am Alten hängenden Bürgern nicht; und da sie nicht gezwungen sind, ihre Kinder aufs Gymnasium zu schicken — dort auch zu wenig aus der Bibel und dem Katechismus, vielmehr Französisch und Englisch gelehrt wird: so senden sie ihre Kinder lieber in Winkelschulen, deren es hier eine Menge gibt, und um die sich weder der Magistrat noch die Prediger kümmern. Überhaupt ist die Anhänglichkeit ans Alte hier ein charakteristischer Zug der Bürgerschaft; und wem daher seine Akzidenzien lieb sind, der muss sich vor dem leicht zu befürchtenden Ruf der Heterodoxie hüten. Daher gibt es denn auch unter den Predigern aller Religionen, weil sie schlecht salariert sind, sehr schlechte Subjekte, und meistens sehr orthodoxe Redner. Unter den verschiedenen Religionsparteien herrsche viel Intoleranz, und die Katholiken sind sehr gedrückt; sie müssen, obwohl sie einen eigenen Prediger haben, ihre Kinder bei einem lutherischen Pfarrer taufen lassen. Der Magistrat aber sorgt nicht für Aufklärung, sondern sucht alle alte Alfanzereien, als vermeintliche Rechte, den Bürgern zu erhalten, um sie für sich zu gewinnen.
Unter den höheren Klassen hingegen fehlt es nicht an Bildung. Der Ton in Gesellschaften, deren es hier in Privat- und öffentlichen Häusern viele gibt, ist sehr freimütig, doch wenig zutraulich und herzlich. – Die vielen öffentlichen Spaltungen hemmen alle trauliche Annäherung, und die meisten Gesellschaften erhalten dadurch ein steifes zeremoniöses Ansehen. Es gibt aber mehrere sehr helle Köpfe, mit denen man, außer bürgerlichen Verhältnissen, einer freien zwanglosen Unterhaltung genießen kann. Sie erkennen das viele Schwankende und Schädliche ihrer Verfassung; und selbst ein Mitglied der Verwaltung, der Bürgermeister v. Schmitz, verdient in Hinsicht seiner Bildung eine rühmliche Erwähnung, Übrigens stand dieser gebrechlichen Verfassung, wie man allgemein versicherte, bei meinem Dort Sein schon eine Veränderung bevor, indem eine Kommission erwartet wurde, um Gericht und Magistrat in Eins zu schmelzen, und den Wechsel des Letzteren ganz aufzuheben. Dadurch dürfte denn Lippstadt ein neues kräftigeres Leben erhalten, und die kommende Generation sich eines besseren, bürgerlichen und sittlichen Zustandes erfreuen.
- Herzogtum Kleve und Grafschaft Mark
Diese beiden schönen Provinzen machen ihrer politischen Organisation nach, e i n e aus, sind aber übrigens, ihrer physischen Beschaffenheit nach, …
[1] Kurzbiografie: Justus von Gruner wurde 1777 in Osnabrück geboren, studierte Rechts- und Staatswissenschaften in Halle und Göttingen. Nach verschiedenen juristischen und administrativen Tätigkeiten trat er 1802 in den preußischen Staatsdienst ein. 1802/03 veröffentlichte er den Reiseroman Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung oder Schilderung des sittlichen und bürgerlichen Zustandes Westphalens am Ende des achtzehnten Jahrhunderts, der Gegenstand der folgenden Beschreibung ist. Gruners Werk richtet sich auf eine Wanderung bzw. Fußreise durch Teile von Westfalen entlang zwischen Rhein und Weser mit dem Ziel, den sittlichen und bürgerlichen Zustand dieser Region am Ende des 18. Jahrhunderts zu schildern. Es handelt sich formal um einen Reiseroman in der Form einer etwas romanhaft eingekleideten Reisebeschreibung – also kein streng wissenschaftlicher Bericht, sondern mit erzählerischen Elementen. Gruner nimmt in diesem Werk eine kritische Haltung gegenüber vielen Zuständen in Westfalen ein: Er bemängelt Rückständigkeit, kirchliche Einflussnahme, soziale und ökonomische Verhältnisse. Gleichzeitig vertritt er eine pro-preußisch-pro-staatliche, säkular-verwaltende Perspektive: Gruner war Anhänger eines aufgeklärten, protestantisch geprägten Verwaltungsstaates. Bedeutung und Rezeption: Das Werk zählt heute zu wichtigen landesgeschichtlichen Quellen für Westfalen um 1800 – gerade, weil es nicht nur das Selbstbild, sondern auch die kritische Perspektive eines Zeitgenossen widerspiegelt. Gleichzeitig war und ist es umstritten: Gruner wurde dafür kritisiert, dass seine Sichtweise sehr „einseitig“ sei – etwa stark von preußischen Reforminteressen geprägt, wenig Rücksicht auf die Eigenheiten der katholischen und ständisch geprägten Territorien in Westfalen nehmend. Es besteht der Verdacht, dass seine Reise und die Publikation zumindest teilweise politisch instrumentalisiert wurden – im Kontext der Säkularisation und Neuordnung westfälischer Territorien (etwa nach dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803) könnte Gruner Daten gesammelt haben, die preußischen Reform- und Aneignungsinteressen dienlich waren. – Gruner beschreibt das Hellweg-Umfeld als von Agrar- und Handwerksbetrieb geprägte Kleinstädte; er bemerkt konservative, kirchlich-geprägte Eliten und eine eher langsame wirtschaftliche Entwicklung außerhalb der Hauptverkehrsachsen. Erwitte/Westernkotten treten bei ihm als typische Hellweg-Orte auf — mit stuben- und kirchenstarken Gemeinschaften, lokalem Handwerk und wenig industrieller Dynamik. – Gruner nimmt Lippstadt als vergleichsweise städtisch-handwerklichen Ort wahr, diskutiert städtische Selbstverwaltung und die Lage im geistlichen Machtgefüge (Herrschaftsverhältnisse). Er erwähnt städtische Institutionen und die Stellung der Bürgerschaft gegenüber Geistlichkeit und Grundherren. (Lippstadt erscheint bei Gruner in einem Hellweg-Kontext.) – Gruner notiert die Bedeutung der Salzwirtschaft/Salinen in der Region (Salinen und Salzgewinnung sind ein wiederkehrendes Thema in seinen Hellweg-Beobachtungen) und charakterisiert die Saline-Orte als wirtschaftlich spezialisiert, zugleich aber sozial und kirchlich konservativ. Bad Sassendorf wird in diesem Zusammenhang als Teil des Salinen-/Heilwasser-Netzwerks gesehen. – Bei Soest nutzt Gruner die Stadt, um zu zeigen, wie mittelalterliche Stadtrechte, klösterliche und städtische Eliten die Gesellschaft prägten. Er kritisiert rückständige Verwaltungs- und Sozialformen, lobt aber einzelne fortschrittliche Gewerbebetriebe; Soest fungiert bei ihm als Beispiel für die Spannungen zwischen alter Ordnung und beginnender Modernität. – Werl wird von Gruner u. a. im Zusammenhang mit Salzgewinnung (Saline / Salinenwirtschaft) und Wallfahrts-/kirchlichen Institutionen erwähnt. Er beobachtet dort die starke Rolle kirchlicher Institutionen (Wallfahrten, Kaland, Stiftungen) und vergleicht das mit preußisch-aufgeklärten Verwaltungsidealen — dabei spart er nicht mit Kritik an kirchlicher Macht und (aus seiner Sicht) Rückständigkeit. – Unna (bzw. die Saline Königsborn / Saline-Region) tritt bei Gruner als Beispiel früher technischer Neuerungen auf — er beschreibt Besichtigungen technischer Anlagen (u. a. frühe Dampfmaschinen in Salinen) und kommentiert wirtschaftliche Produktivität und Arbeitsverhältnisse. Zugleich kritisiert er konservative soziale Strukturen. – Geseke taucht in Gruners Hellweg-Berichten punktuell auf; dort notiert er Pacht- und Grundverhältnisse sowie die Stellung ländlicher Pächter gegenüber kirchlichen und weltlichen Grundherren — also Hinweise auf Agrar- und Eigentumsstrukturen.
[2] Siehe Teilpräsentation unter folgendem Link: https://books.google.de/books?id=Q84bHtkljJsC&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
[3] Vgl. meinen Aufsatz: Philipp Korte – ein Pfarrer stellt die Salzproduktion in Bad Westernkotten und
Salzkotten auf neue Füße, auf meiner HP unter „Aufsätze 2024“.
[4] Transkribiert mit einigen Anpassungen in Bezug auf heutige Rechtschreibung und Grammatik sowie Wortwahl. Die digitale Version weist allerdings etliche Seitenlücken auf. Und dafür, mir das Buch anzuschaffen, waren mir die Kosten mit 75 Euro zu hoch.