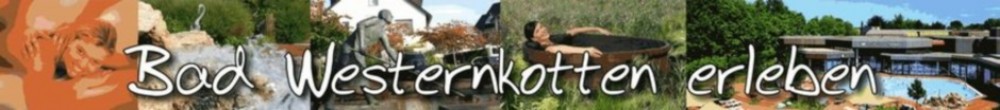Wolfgang Marcus (Bad Westernkotten)
In der Broschüre „Heimatpflege in Westfalen“, 26. Jahrgang, 1/2013, las ich vor vielen Jahren den Artikel mit der Überschrift „Die „Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank” (DWUD) – auch ein Fundus für die Heimatkunde.“ Darin heißt es zum Internet-Portal „Westfälische Geschichte“:
„Die archivische Überlieferung in Westfalen-Lippe ist ebenso vielfältig wie zerstreut. Dies gilt gerade für die Urkundenüberlieferung, die sich heute auf viele staatliche, kommunale, private und kirchliche Archive verteilt. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, ist somit gezwungen, viele Orte aufzusuchen. Schon in den 1930er Jahren wurde deshalb von Archivaren der Plan entwickelt, – über die Archiv- und Bestandsgrenzen hinweg einen Gesamtnachweis aller westfälischen Urkunden zu schaffen. „Analog“, also auf Karteikarten, wurden seitdem von den Mitarbeitern der Vorläufer-Einrichtungen des heutigen LWL-Archivamts für Westfalen inhaltliche Zusammenfassungen des Rechtstextes von Urkunden – sog. Regesten — verfasst, die im Rahmen von Betreuungs- oder Erschließungsarbeiten in die Hand genommen worden waren. Auf diese Weise kamen bis in die 1970er Jahre rund 65.000 chronologisch geordnete Regesten aus über 250 Archivbestanden aus ganz Westfalen-Lippe zusammen. Qualität und Umfang der Einzelregesten sind sehr unterschiedlich und reichen von einfachen Kurzregesten bis hin zu umfangreichen und sorgfältig erarbeiteten Vollregesten, die modernen archivischen und historischen Ansprüchen genügen, von handschriftlich ausgefüllten Karteikarten bis hin zu maschinenschriftlichen Texten. Mehr und mehr zeigte sich jedoch, dass diese Menge mit konventionellen Mitteln nicht mehr zu schultern war. Mit dem neuen Informationsmedium ‚Internet‘ bot sich viele Jahre später dann die Chance, die Kartei zu reaktivieren, ihre Daten elektronisch weiterhin pflegen und darüber hinaus über das World-Wide-Web auch öffentlich nutzbar machen zu können.
Der Dornröschenschlaf der Kartei ist seit einem Jahr vorbei. Auf Initiative des Internet-Portals „Westfälische Geschichte“ des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte in Münster wurde das Projekt einer „Digitalen Westfälischen Urkunden-Datenbank“ – kurz DWUD – zusammen mit dem LWL-Archivamt für Westfalen (Dr. Peter Worm) angegangen und diese Ende 2011 freigeschaltet.
Zentrales Ziel beider Partner war es, diesen kulturellen Schatz zu heben: Hierfür musste das vorhandene Regesten-Material, das in Form von Karteikarten vorlag, zunächst digitalisiert und z. T. manuell erschlossen werden, um es auffindbar zu machen. Wenn auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht bei allen Datensätze auch die Textinhalte recherchiert werden können, da bei etwa der Hälfte nur Bilder (Scans) der Karteikarten verfügbar sind, so sind doch alle Regesten mindestens über das Ausstellungsdatum und die Herkunft (Provenienz) abfragbar. Insbesondere die zwingend notwendigen Provenienz-Angaben erlauben es, das Stück einwandfrei zu identifizieren und ggf. im Archiv einsehen zu können. Daneben wurden bereits jetzt elektronisch vorhandene Findbücher, in denen die Regesten verzeichnet sind, eingespeist – und nicht nur solche des LWL-Archivamts und der von ihm betreuten Archive. Denn es ging bei diesem Projekt ja gerade darum, einen Urkundenpool zu schaffen, der für die gesamte westfälisch-lippische Urkundenüberlieferung offen sein sollte. Deshalb finden sich in DWUD nicht nur Bestände des LWL, sondern v. a. solche vieler kommunaler, privater (z. B. Adelsarchive), kirchlicher (z. B. Bistums- und Pfarrarchive) und staatlicher Träger. Insbesondere das Landesarchiv NRW hatte schon früh seine Bereitschaft erklärt, alle Urkundenbestände digital für das Portal zur Verfügung zu stellen, sodass auch wichtige Territorialarchive in DWUD enthalten sind. Insgesamt sind heute über 90.000 Urkundenregesten aus rund 250 Archivbeständen verfügbar – für eine Region einzigartig in Deutschland. Als Urkunden-Portal für Westfalen-Lippe fungiert seitdem das Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ (http://www.westfaelische-gechichte.lwl.org), das zusammen mit dem Archivamt die Datenbank betreut und um weitere Regesten ergänzt.
Die Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank ist angelegt als Arbeitsinstrument, nicht als Zimelien- Schau. [Als Zimelien bezeichnen Bibliothekare und Sammler seltene und wertvolle alte Drucke, illuminierte Manuskripte und besondere Dokumente mit Unikat-Charakter, die in Bibliotheken gesondert aufbewahrt werden. WM] Zielgruppen sind neben dem Fachpublikum insbesondere die Orts- und Heimatforschung, die Genealogie, aber auch die Lehre.
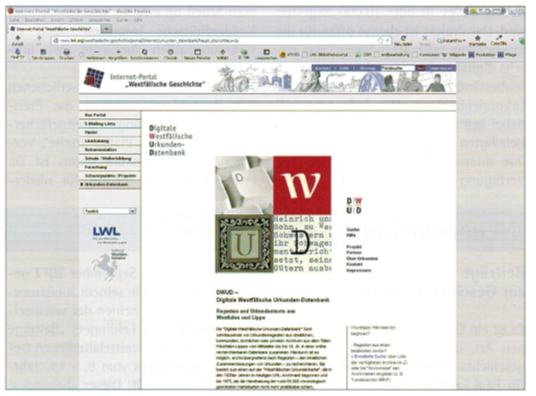
Das Urkundenprojekt soll die Nutzenden via Internet in die Lage versetzen, kostenfrei, zeit- und ortsunabhängig auf das umfangreiche Quellenmaterial zur Westfälischen und Lippischen Geschichte zugreifen zu können. Zudem wird ein flächendeckender und niedrigschwelliger Zugriff ermöglicht, der in Form einer selbst generierenden Nutzung die Beschäftigung mit Westfälischer Geschichte stimulieren könnte. Mit DWUD sparen die Nutzer Zeit und Geld, da nun eine einfache, übergreifende Suche der sonst verstreut liegenden und i. d. R. nicht publizierten Urkundenbestände durchführbar ist – ein Fundus für die Heimatgeschichte. So können – zielgenau über verschiedene Datenfelder, Indizes oder Karten — Orte und Namen in der Datenbank recherchiert werden, mitunter erhält der Nutzer nun Informationen auf Bestände, an die er nie gedacht hätte. Aber er kann auch, wie in einem Findbuch, lediglich innerhalb eines Bestandes von einem zum nächsten Regest blättern. Ein besonderes Feature ist hierbei die phonetische Suche, sodass – für Orts- und Familiennamen aus Mittelalter und Früher Neuzeit unabdingbar – auch nach dem Wortlaut eines Wortes recherchiert werden kann. Insgesamt erlaubt es DWUD, neue Fragestellungen auf das Material anzuwenden und Beziehungen zwischen Personen und Orten sichtbar zu machen.
Das Projekt ist offen für weitere teilnehmende Archive, und zwar unabhängig davon, ob es 10 oder 10.000 Regesten sind. Das Projekt ist ebenso offen für die Einspeisung oder auch Spiegelung bereits digital vorhandener bzw. neuer Datenbestände oder auch von gedruckten Urkundenbüchern. Die Teilnahme soll dabei keine Einbahnstraße sein, da die beteiligten Institutionen die Daten für ihre internen Informationssysteme zur Verfügung nutzen können. In qualitativer Hinsicht soll das Material weiter optimiert werden, z. B. durch eine Indexierung der Regesten, etwa in Hinblick auf Orts- und Personennamen – was jedoch angesichts der benötigten Fachkräfte erhebliche finanzielle Ressourcen erfordert, Auf der Agenda stehen ebenso die weitere Texterfassung der Digitalisate oder die Einspeisung von Urkundenbüchern (z. B. Westfälisches Urkundenbuch). Denkbar wäre ebenso, die Daten um die Abbildungen der Urkunden selbst zu ergänzen.
Die „Digitale Urkunden-Datenbank“ ist erreichbar über das Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ und direkt über die URL http://www.dwud.lwl.org. Kontakt: Dr. Marcus Weidner, LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte, Karlstraße 33, 48147 Münster, Tel.: 0251 591-5691, E-Mail: marcus.weidner@lwl.org
Möglichkeiten dieser digitalen Datenbank, die ich sehe:
- Ich lerne ganz viel über Urkunden. So heißt es auf der o.g. HP: „Was ist eine Urkunde? – In einer Urkunde werden rechtserhebliche Vorgänge unter Beachtung bestimmter äußerer, sprachlicher und inhaltlicher Formen schriftlich festgehalten. Verhandlungsgegenstand sind immer Einzelrechte, das heißt, dass in Urkunden nicht allgemein gültiges Recht gesetzt wird, sondern dass ein klar umrissener Rechtstitel verhandelt wird. Konkret kann das z. B. die Schenkung, der Verkauf oder der Tausch eines Grundstücks sein, es können Heirats- und Erbschaftsverträge oder politische und militärische Bündnisse in Urkundenform geschlossen werden. Schließlich können aber auch ganz profane Geldgeschäfte wie Rentkäufe in einer Urkunde festgehalten werden. – Gemeinsam ist den meisten diesen Urkundentypen, dass es einen Aussteller und einen Empfänger gibt – einen, der den Rechtstitel (oft gegen eine klar definierte Gegenleistung) abtritt, und einen, der der neue Inhaber dieses Rechtstitels wird. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass das Rechtsgeschäft „auf eine Kuhhaut gehen“ muss – sprich, dass der Text auf die Vorderseite eines Pergaments, später auf einen Bogen Papier passt. Erst seit dem 18. Jh. werden Urkunden in Form von gebundenen Heften oder Büchern für besonders feierliche oder umfangreiche Urkunden zugelassen, man spricht von sog. Libell-Formen…“
- Was ein Regest ist. „Das Regest soll in knapper und eindeutiger Weise den rechtlichen Kern einer Urkunde zusammenfassen. Es folgt dabei in der Regel dem immer gleichen logischen Aufbau: Beschreibstoff und manchmal die Größe des Pergaments; Sprache; Entstehungsstufe (Entwurf, Original, Abschrift); Anzahl und Art der Siegel (anhängend, aufgedrückt, Wachs- oder Lacksiegel, Material aus dem die Pressel, mit denen die Siegel befestigt sind, bestehen); Manchmal wird das Siegelbild oder die -umschrift beschrieben; Rückvermerke (ehemalige Signaturen oder Zusammenfassungen der Urkunde). Bei einer möglichst kompletten Erfassung aller Informationen spricht man von einem Vollregest; werden nur die Kerninformationen (Wer? – Was? – Wann? – an Wen?) erfasst, bezeichnet man das Ergebnis als Kurz- oder Kopfregest.
- Was Urkundeneditionen sind: „So werden dagegen häufig die Volltexte der Urkunden in der Originalsprache und -text abgedruckt; das Kopfregest leitet eine solche Edition ein. Auch nicht rechtserhebliche Teile der Urkunde wie die Narratio, die die Vorgeschichte und das Zustandekommen der Urkunde beschreibt, oder die Straf- oder Poenformel, die die Folgen des Zuwiderhandelns gegen die urkundlichen Bestimmungen beschreibt, können mit Hilfe einer Edition untersucht werden. Bezieht man die Edition auf einen geografischen Bezug so nennt man das Ergebnis auch „Urkundenbuch“ – das größte Projekt in unserem Raum ist das Westfälische Urkundenbuch (WUB), daneben gibt es vor allem städtische Urkundenbücher.“
- Was ist ein Faksimile? – „Als Faksimile bezeichnet man den bildlichen Abdruck einer Urkunde. Auch diese Art der Veröffentlichung wird meist von einem Kopfregest, oft auch von einer Transkription – einer wortwörtlichen, meist zeilengenauen Abschrift des Textes – begleitet. Anhand solcher Ausgaben können die äußeren Merkmale wie Schrift und grafische Symbole erforscht werden. Jüngst erfüllen am Bildschirm zu betrachtende Digitalbilder, sogenannte Digitalisate, diese Funktion. Viele Archive haben begonnen, ihre Urkundenbestände zu digitalisieren und den Benutzern das angefragte Material elektronisch zu präsentieren.“
- „Letztlich gibt es nur wenige wissenschaftliche Fragestellungen, die sich ausschließlich am Original klären lassen. Vor allem hilfswissenschaftliche Fragen zum benutzen Beschreibstoff oder Details des Schrift- und Siegelbilds erfordern die Einsicht in die Originale.“
- Ich kann aus diesen Urkunden, vor allem aber auch durch die Regesten, also Zusammenfassungen, viel über meine Heimatstadt Westernkotten und ihre Umgebung erfahren! Und bekanntlich zeigt sich oft die Weltgeschichte sogar in der „kleinen“ Geschichte von Westernkotten!
Abschließend kann ich nur sagen: Man muss sich immer mehr in die Chancen und Möglichkeiten dieses Internet-Portals hineinarbeiten, um großen Nutzen daraus zu ziehen!