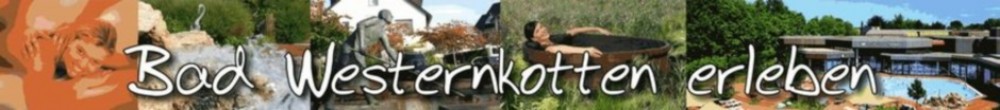Wolfgang Marcus
Die Menschenrechte wurden offiziell erstmals in der „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ im Jahr 1789 während der Französischen Revolution erklärt. Diese Erklärung war ein grundlegendes Dokument, das die Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit (Liberté, Egalité, Fraternité) festlegte und als ein Meilenstein in der Geschichte der Menschenrechte gilt.- Auf internationaler Ebene wurden die Menschenrechte später durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 weiter festgeschrieben. Diese Erklärung wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und stellt heute eine grundlegende Grundlage für die Rechte und Freiheiten jedes Menschen dar.
Aber schon mehr als 250 Jahre früher gab es eine frühe, noch sehr viel einfachere Erklärung. Davon soll im Folgenden die Rede sein.
Auf meinem Harenberg-Kalender „Chronik 2025“ las ich am 20. März etwas über eine frühe Formulierung der Menschenrechte. Dazu heißt es: „Vor 500 Jahren: Frühe Erklärung der Menschenrechte – Die am 20. März 1525 im Deutschen Bauernkrieg (1524/25) aufgestellten Zwölf Artikel von Memmingen gelten als frühe Formulierung der Menschen- und Freiheitsrechte in Europa. – Bauernkrieg: Der Aufstand der Bauern sowie einiger Städte in Süd- und Mitteldeutschland richtete sich gegen die feudale und geistliche Macht. Am 6. Marz 1525 trafen sich in Memmingen etwa 50 Vertreter der oberschwäbischen Bauerngruppen, um das gemeinsame Auftreten gegenüber dem Schwäbischen Bund zu beraten. Nach weiteren Treffen verabschiedeten sie am 20. Marz die Zwölf Artikel. Nach der Niederlage der Bauern am 15. Mai in der Schlacht bei Frankenhausen wurde Thomas Müntzer (um 1489-1525), einer ihrer Anführer, im thüringischen Mühlhausen hingerichtet. Die in hoher Auflage gedruckten Zwölf Artikel verbreiteten sich jedoch im gesamten Reich.
Inhalt: Zu den Forderungen gehörten u.a. die Aufhebung der Leibeigenschaft, die Freiheit der Jagd und des Fischfangs sowie die Linderung der Armut. Einige der freiheitlichen Grundgedanken wurden in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung (1776) und in den Forderungen der Französischen Revolution (ab 1789) aufgegriffen.
Hier ein Titelblattholzschnitt:
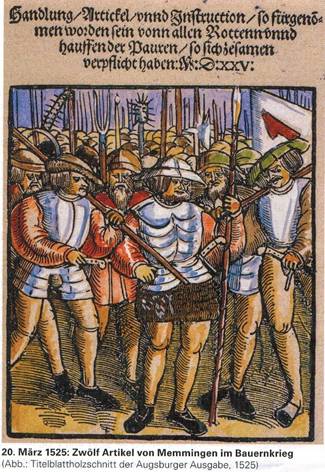
Was wurde davon wann in Westernkotten umgesetzt?
In Westernkotten ist schon früh von der Abschaffung der Leibeigenschaft die Rede. ChatGPT sagt dazu: „Die Leibeigenschaft[1] in Westernkotten wurde im Rahmen der Bauernbefreiung und der Reformen von 1807 abgeschafft, als das Preußische Edikt die Leibeigenschaft in den preußischen Gebieten, zu denen auch Westernkotten gehörte, abschaffte.“ [2]
Aber hier irrt ChatGPT. Die Abschaffung erfolgte in Westernkotten schon deutlich früher. Darüber berichtet das Heimatbuch von 1987. Hier kommt der Begriff „Leibeigenschaft 12-mal vor. Ich zitiere und erläutere die wichtigsten Stellen:
-1687/88 kam es im Rahmen von Auseinandersetzungen zwischen dem Bistum Paderborn und dem Erzbistum Köln zu einem umfangreichen Gerichtsverfahren und einem Rezess. Dazu heißt es: „Der Rezess regelte jedoch nicht nur landeshoheitliche und gerichtliche Fragen, sondern er beinhaltete auch wirtschaftliche und soziale Veränderungen, die sich zugunsten Westernkottens auswirkten. So wurde bereits 1688 die Leibeigenschaft in Westernkotten aufgehoben. Von nun an war auch die Erblichkeit der Güter möglich, sie konnten z.B. durch testamentarische Verfügung auch an Fremde übergehen. Selbst auf alle früheren Einkünfte wie Frondienste, Kopfzins, Sterbe- und Erbfälle sowie auf sonstige Privathuldigungen und Leistungen aus Erwitte und Westernkotten musste der Paderborner Bischof auf den Druck Kölns hin von nun an verzichten. An weiteren Bestimmungen legte der Rezess auch folgendes fest: Die Willkommensteuer, die die Westernkottener und Erwitter Bürger beim jeweiligen Amtseintritt eines Paderborner Bischofs zu bezahlen hatten, wurde von 200 Talern auf 100 herabgesetzt, ebenso ermäßigten sich die steuerlichen Abgaben für Wein und Branntwein. – Köln war es somit nach zahlreichen Streitigkeiten und Vergleichen gelungen, über den Königshof in Erwitte und damit auch über Westernkotten die vollständige Landeshoheit zu erreichen. Das Bistum Paderborn hatte nahezu die Mehrzahl all jener Rechte, die es seit der Schenkung des Königshofes im Jahre 1027 in Erwitte und Westernkotten hatte, verloren und war auf die privatrechtliche Rolle eines Grundeigentümers zurückgewiesen. Die erzielten Vereinbarungen hatten nun fortan in den Gemeinden Erwitte und Westernkotten ihre Rechtsgültigkeit, bis beide Orte 1803 unter hessische Herrschaft und einige Jahre darauf, 1815, unter preußische Herrschaft gelangten.“[3]
„Durch den Rezess … wurde auch die Leibeigenschaft aufgehoben; das Recht eines jeden Leibherrn wurde somit hinfällig, Eigenhörige zu verkaufen oder auszutauschen. Somit waren die Westernkötter eigentliche Nutznießer der jahrhundertelangen Streitigkeiten zwischen Köln und Paderborn um die Landeshoheit über Erwitte und Westernkotten. Denn die einzelnen Rezesse bewirkten für Westernkotten weitgehende Rechte und Privilegien, die zum Beispiel mit der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre 1687 für die Verhältnisse jener Zeit ungewöhnlich freizügig waren.“ [4]
-1778: Das spiegelt sich auch in der Satzung für die Salzsieder/Södder aus dem Jahr 1778 wider: „Die Leibeigenschaft gibt es nicht mehr, uneheliche Geburt und akatholische Konfession werden nicht mehr als Hindernisse betrachte.“ [5]
-1809: „Der Großherzog von Hessen hob durch Gesetz vom 5. 11. 1809 die Leibeigenschaft auf. Die Pächter, Colonen genannt, erhielten nun die von ihnen bewirtschafteten Höfe und Ländereien als volles Eigentum zugesprochen. Während alle die an der Person haftenden Verpflichtungen dem Grundherrn gegenüber, wie grundherrlicher Ehekonsens, Sterbefall, Gerichts- und Jagddienst wegfielen, so blieben die am Boden haftenden Verpflichtungen vorerst bestehen. Diese waren z.B. Grundzinsen sowie Hand- und Spanndienste. – Es muss an dieser Stelle betont werden, dass, obwohl auch im hiesigen Raum noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts Leibeigenschaft durchaus bestand, Westernkotten davon nicht mehr betroffen war. Der Streit zwischen Köln und Paderborn um die Landeshoheit in Erwitte und Westernkotten hatte bereits durch den Rezess im Jahre 1687 die Abschaffung der Leibeigenschaft für die Westernkötter zur Folge.“ [6]
Eine weitere Entwicklung war die sog. Bauernbefreiung im 19. Jahrhundert. Aber das ist ein anderes Thema.
[1] Die Leibeigenschaft bezeichnet eine im Mittelalter weit verbreitete persönliche Abhängigkeit von Bauern von ihrem Grundherrn; die Erbuntertänigkeit stellt eine besonders strenge Variante dar. Die leibeigenen Bauern bewirtschafteten Höfe, die ihren Grundherren gehörten, und mussten dafür Pacht (Gült) zahlen.
[2] Zugriff am 01.04.2025
[3] Seite 50
[4] Ebd. S. 51
[5] Ebd. S. 81
[6] Ebd. S. 156