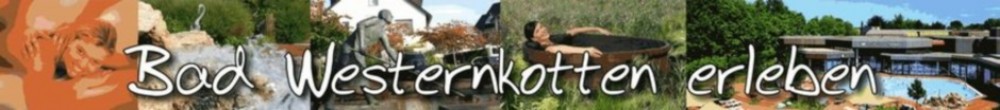Von Pfarrer Walter Wahle, Störmede
Erstabdruck: Lippstädter Heimatblätter 1987, S.17-19
In den Veröffentlichungen der Volkshochschule Mohne-Lippe hat Clemens Böckmann „Die jüdische Gemeinde in Erwitte” behandelt, eine für die Ortsgeschichte sicherlich sehr erfreuliche Arbeit. Hier sollen einige Ergänzungen geboten werden hauptsächlich aus der Regierungszeit des Kurfürsten Joseph Clemens (1688-1723). Vornehmlich handelt es sich um Mitteilungen aus den Protokollbüchern der kurfürstlichen Hofkammer in Bonn, der für die Juden zuständigen Zentralbehörde, und denen des Hofrats, der obersten Regierungsstelle des Kurstaates Köln. Diese Angaben sind sehr kurz, da die zu Grunde liegenden Eingaben mit Darstellungen der Sache fehlen oder nicht eingesehen werden konnten.
In dem kurzen Berichtszeitraum sind naturgemäß Vergleichssachen verhältnismäßig stark vertreten. Bei der grundlegenden Neuordnung des Judenwesens im Herzogtum Westfalen durch die Judenordnung von 1700 wurden in Erwitte zwei Juden vergleidet. Da in einer späteren Aufzählung drei erscheinen, war einer wohl schon länger ansässig (HW LA XI, 6). In Westernkotten erhielt 1700 ein Jude namens Levi die Vergleidung. Dort war nur eine Judenstelle. Daher ist anzunehmen, dass er erst kurz zuvor nach dort gekommen war. Denn am 15. Juli 1697 wurde der damalige Vorgänger der Juden im Herzogtum Westfalen, Meyer zum Goldstein, beauftragt, über Leifman Joisten, der Vergleidung nach Westernkotten beantragt hatte, sowie einige andere, Bericht zu erstatten über deren Handel und Vermögen. Zugleich wurde ihm aufgegeben, davon eine vom Hebräischen in das Deutsche übersetzte Abschrift vorzulegen. (KK IV, 4530, Bl. 99). Entweder ist Leifman das Gleid versagt worden, oder er ist alsbald wieder verzogen. Der 1700 genannte Levi erscheint auch 1712 noch in Westernkotten. In Erwitte hat es dagegen um diese Zeit bereits Änderungen gegeben. Während 1700 dort Josell, Isack und Jacob genannt werden, erscheinen in der Liste von 1712 als 1700 vergleidet Jobst Leasar und Meyer.
Hinzugekommen sind Jackel mit Gleid vom 29. Januar 1705 (KK IV 4542, Bl. 10), der 1700 nach Oestinghausen vergleidet war, und Isack Jacob, dessen Gleid das Datum vom 5. Februar 1708 trug (HW LSt Zentralbeh.3). Dieser war Schwiegersohn des Jobst Leyser, der auch für ihn das Gleid beantragt hatte. Da in Erwitte gerade ein Judenplatz frei war, wurde das Gesuch genehmigt (KK IV 4545, Bl. 15). Er konnte also neben seinem Schwiegervater Haushalt führen und Handel treiben. Da der von Oestinghausen Zugezogene 1900 vergleidet war, trat keine Erhöhung der Judenzahl im Lande ein. Jedoch müsste eine 1700 in Erwitte aufgeführte jüdische Familie ausgestorben oder verzogen sein.
Ende 1715 stellte Jude Meyer in Erwitte den Antrag auf Erteilung eines Hochzeitspatents für seine Tochter zum 8. Januar 1716, was die Hofkammer genehmigte. (ebd. 4548, Bl. 294).
Bei Eintragungen vom 13. und 14. September 1720 ist den Protokollführern offenbar ein Irrtum unterlaufen. Jobst Laisser (Laisar) aus Erwitte hatte Umschreibungen seines Gleids auf seinen Enkelsohn Lazarus Laffman (KK IV 4559, Bl 116) beantragt, nach der anderen Fassung auf seinen Vetter Lazarus Leffman (ebd., 4560, Bl. 112). Er selbst wollte dabei im Gleid bleiben. Dem Gesuch gab die Hofkammer statt mit dem Vorbehalt, dass der alte Jude wirklich seinen Handel aufgebe (KK IV, 4559, Bl. 116). Andernfalls werde das Gleid ungültig.
Nach der zweiten Fassung hatte Jobst Laisar seinen Handel bereits eingestellt. (KK IV, 4560, Bl. 112)
Während die Juden bei Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften das Entgegenkommen der Behörden fanden, suchten sie das Wohlwollen der Regierung offensichtlich auch durch Einschaltung ihrer Selbstverwaltung bei Durchführung der Gesetze.
So zeigte der Vorsteher der westfälischen Judenschaft 1722 der Hofkammer an, dass Salomon Moyses zu Erwitte vier Söhne im Hause habe, die selbständig Handel trieben. Er beantragte die Ausweisung von drei Söhnen. Die Hofkammer wies darauf den Richter zu Erwitte an, wenn der Fall so liege, solle er antragsgemäß verfahren (KK IV 4562, Bl. 83). Hier ging es wohl darum, einerseits sich den Staat gewogen zu erhalten, andererseits die wirtschaftliche Lage der zugelassenen Familien nicht durch übergroße Konkurrenz zu erschweren.

Eine Gruppe Erwitter Heimatfreunde vor den Gebäuden der ehemaligen Synagoge. Das Haus war über 100 Jahre in jüdischem Besitz. Der linke Vorbau diente bis in die Mitte der dreißiger Jahre als Synagoge.
Das 19. Jahrhundert brachte mit der bürgerlichen Freiheit der Juden auch ein Anwachsen ihrer Zahl, wie Böckmann nachweist. 1845 verfügte die preußische Verwaltung, dass alle Juden einen erblich bleibenden Familiennamen anzunehmen hätten. Im Herzogtum Westfalen brachte dies kaum Veränderungen, weil diese Regelung bereits um 1800 abgeschlossen war. Jedoch veröffentlichte die Regierung Arnsberg die nunmehr endgültigen Namen der im Regierungsbezirk ansässigen Juden. Dabei werden für Erwitte aufgeführt: Witwe Margoli Cohn, Philipp Eber, Jacob Elsbach, Isaac Elsbach, Leser Fischbein, Louis Lilienfeld, Bendix Rathheim, Markus Rosenberg, Isaac Schreiber, Emanuel Schüler, Emanuel Stern, Herz Stern, Isaac Stern, Leeser Stern, Nathan Stern, Witwe Hannchen Sternberg (HBL 45 (1964) S. 36). In Westernkotten wohnten: Isaac Eichenwald, Abraham Halle, Joseph Stein, Aron Weinberg und Leeser Weinberg (ebd.).
Dass die Juden in der kölnischen Zeit dafür, dass sie ihren Schutzzoll entrichten, auch den Schutz des bürgerlichen Rechtes genossen, wenn sie dessen Boden nicht selbst verließen, zeigen auch für den kurzen Zeitraum, den wir betrachten, einige Beispiele. Am 29. April 1698 ordnete der Hofrat in Bonn an, das Gericht Erwitte solle den dort vergleideten Juden Gottschalck alsbald gegen Kaution aus der Haft entlassen und ihm die Abschrift des Vernehmungsprotokolls zustellen, damit er sich dazu äußern könne. (KK III, 79 A, Bl. 202). Worum es sich hier handelt, ist aus dem Protokollauszug nicht zu erkennen. Vielleicht ist dieselbe Frage angeschnitten wie am 27. Juni 1698. Ein nicht genannter Jude war zu Erwitte wegen „falscher Münze” — ob wegen Herstellung oder Vertrieb, ist nicht angegeben — in Haft. Richter Biscopinck wurde aufgegeben, die Untersuchung zu führen, die Gegengründe zu den Einlassungen des Juden diesem zu übergeben zu seiner Stellungnahme und über das gesamte Verfahren an den Hofrat zu berichten. (KK III, 80, Bl. 145)
1706 klagte Josten Lazar, daf3 man ihn zu Unrecht mit einer Brüchte [Brüchte, auch Brüchten oder Brüchtengeld, waren im Mittelalter und der frühen Neuzeit von der niederen Gerichtsbarkeit für kleinere Vergehen verhängte Strafgelder oder Naturalabgaben] belegt und diese zwangsweise beigetrieben habe. Der Hofrat anerkannte, dass Lazar Unrecht geschehen war und machte beim Domkapitel, das damals die Regierung führte, Vorschläge, was zur Handhabung der Justiz erforderlich sei. (ebd. 87, Bl. 113) Ebenso hatte Isaac Jacob Erfolg, als er 1717/18 auf Einhaltung eines Vertrages klagte. Der Richter zu Erwitte erhielt die Anweisung, ihn bei dem Vertrag zu handhaben, wenn keine rechtlichen Bedenken beständen. (ebd. 100, Bl. 68). Anscheinend hatte Heinrich Löper die Nichtigkeitserklärung des Vertrages beantragt. Denn am 16. Juli 1718 verfügte der Hofrat, zur Aufhebung des Vertrages bestehe kein Grund. Daher habe der Richter die Kontrahenten zur Ausführung des Vertrages anzuweisen. (ebd. Bl. 128)
Umgekehrt mussten die Juden sich auch vor den ordentlichen Gerichten verantworten, wenn sie gegen die allgemeinen Gesetze verstießen. 1705 hatte der Judenvorgänger Meyer zum Goldstein Anzeige gegen Jobst Levi zu Erwitte (oder handelt es sich um den für Westernkotten bezeugten Levi?) erstattet, weil er bei reisenden und packtragenden Juden die Nachricht verbreitet habe, der Leibzoll der Juden sei aufgehoben. Daher brauchten sie den Zöllnern keine Zollzettel mehr vorzuzeigen. Der Gerichtsschöffe Barthold aus Geseke erhielt den Auftrag, die Angelegenheit zu untersuchen, ob Levi das Gericht nur in die Welt gesetzt habe, um das Dekret zu unterlaufen (KK IV, 4542, Bl. 107). Das Ergebnis dieser Untersuchung ist nicht bekannt. Es handelt sich hier wohl nicht um einen Einzelfall. Denn um diese Zeit waren wegen des Leibzolls der Juden Unklarheiten entstanden, deren Klärung dem Pächter des Judenzolls im Herzogtum Westfalen aufgetragen wurde (vgl. ebd. 4543, Bl. 106, 4544, Bl. 107).
1720 wird Jobst Lazarus, Vorsteher zu Erwitte, erwähnt (KK III, 102, Bl 19). Welches Amt er als Vorsteher bekleidete, ist nicht näher bezeichnet. Eine besondere jüdische Gemeinde hat es bei der geringen Zahl der Juden damals in Erwitte wohl noch nicht gegeben. Wohl bestanden bestimmte Bezirke, in denen die Juden unter ihren Vorstehern zusammengefasst waren. 1711 genehmigte die Hofkammer eine Zusammenkunft der westfälischen Judenschaft in Erwitte, wie sie regelmäßig alle drei Jahre stattfand zur Festsetzung der Umlagen für Tributzoll und Taxen. (ebd. 4547, Bl. 62). Auch 1718 stellte die westfälische Judenschaft einen solchen Antrag, in Anröchte oder Erwitte zusammen kommen zu dürfen. Es wurde ihr von der Hofkammer freigestellt, welcher Ort ihr bequemer sei. (ebd. 4555, Bl. 65).
Der oben erwähnte Jobst Lazarus erhielt auf seine Eingabe den Bescheid, dass den Gerichten im Erzstift Köln, zu deren Bezirk seine Schuldner gehörten, aufgegeben werden sollte, ihm auf seine Anzeige hin zum Rechte verhelfen (KK III, 102, Bl. 19). Danach umfasste sein Geschäftsbereich einen größeren Bezirk. Entsprechend wird man bei ihm auf einen gewissen Wohlstand schließen können, wie er sich auch als Vorsteher eines größeren Ansehens erfreute als die Mehrzahl seiner Glaubensgenossen.
Im Übrigen lassen sich aus den eingesehenen Quellen keine Schlüsse auf die wirtschaftliche Lage der Erwitter Juden ziehen. Einzig finden wir ein Beispiel, das auf Wohlstand schließen lässt, 1848 bei Ausschreibung der preußischen Staatsanleihe. Diese Anleihe fand in Westfalen wenig Anklang. Im ehemaligen kölnischen Westfalen finden wir als Zeichner vor allem Beamte, daneben auch Juden, denen gerade in dieser Zeit der Staat größere Freiheiten gewährte. In Erwitte erscheint in den Zeichnungslisten allein Emanuel Schüler mit 100 Thlr, neben wenigen Privatpersonen. Die übrigen Judenfamilien waren vielleicht dazu nicht in der Lage. (vgl. HBL 44 (1063) S. 73)
Im Allgemeinen galten die Juden im Herzogtum Westfalen mit der Zahlung des jährlichen Judentributes als befreit von den gewöhnlichen Landessteuern. Eine Ausnahme bildeten Sondersteuern, der sog. Kopfschatz, der unregelmäßig erhoben wurde. Wohl wegen des Ausnahmecharakters bezahlten manche Juden den Kopfschatz von 1717, eine sog. Türkensteuer, nicht. Solche Schatzungen wurden bei den jüdischen Pflichtigen nicht durch die kurfürstlichen Beamten eingezogen, sondern durch die Vorsteher der Juden und von ihnen gesamt an die Einnehmer abgeben. Als 1717 Schwierigkeiten auftraten, wurde den Vorstehern zugestanden, dass sie die Hilfe der Beamten bei der zwangsweisen Beitreibung des Kopfschatzes anfordern konnten (KK III, 99, Bl. 43). Als die Richter gegen die Säumigen vorgingen, wurde den Richtern von Werl und Erwitte Einhalt geboten, weil erst die Umlagelisten der Türkensteuer von 1685 mit dem Auszug der westfälischen Judenschaft nachgesehen werden solle. (ebd. Bl. 171)
Quellen und Literatur
- Böckmann, Clemens, Die jüdische Gemeinde in Erwitte. Die Aufarbeitung von fast 300 Jahren jüdischer Geschichte in einer kleinen Stadt. Herausgeber: Volkshochschule Möhne-Lippe des Kreises Soest 1986.
- HBL= Heimatblätter (Lippstadt) Beilage zum „Patriot“
- HA LA = Staatsarchiv Münster, Herzogtum Westfalen, Landesarchiv
- HW LSt Zentralbeh-= Staatsarchiv Münster, Herzogtum Westfalen, Landstände, Zentralbehörde
- KK III = Hauptarchiv Düsseldorf, Kurköln, Hofrat
- KK IV = Hauptarchiv Düsseldorf, Kurköln, Hofkammer